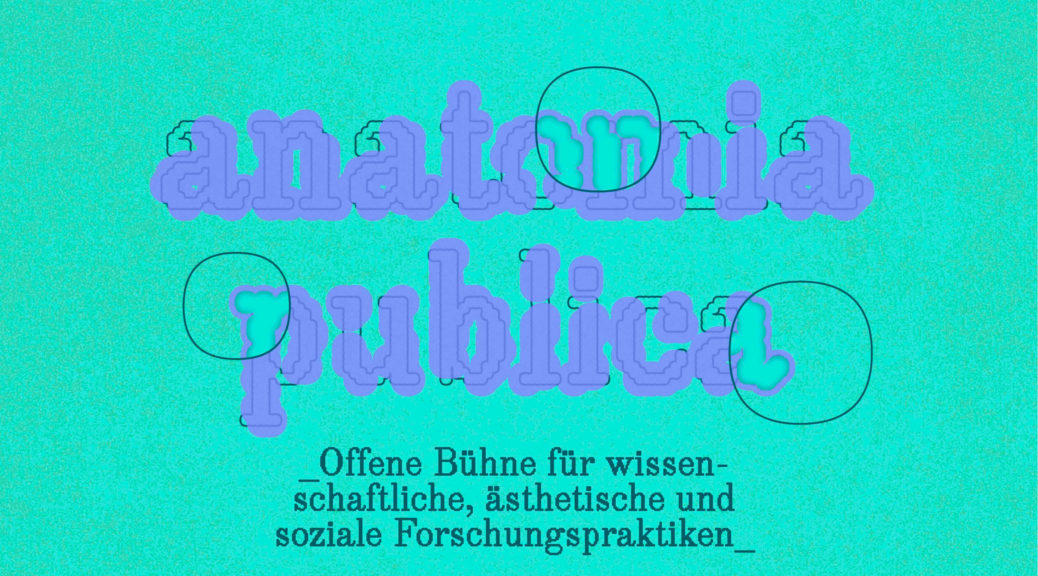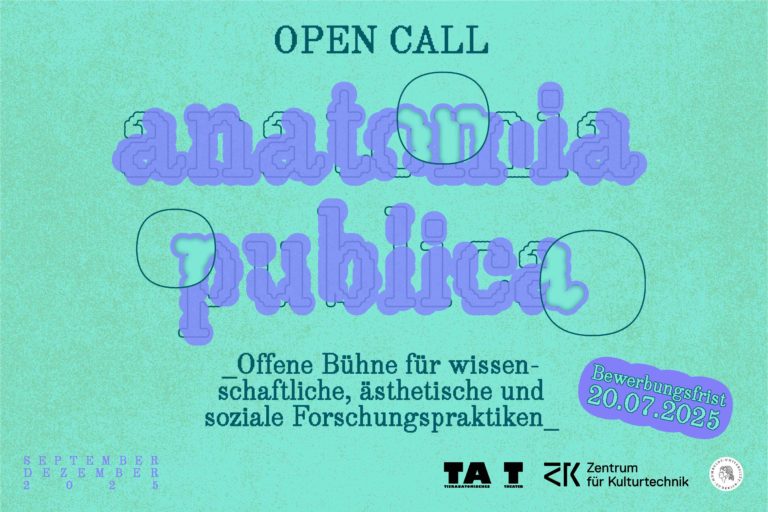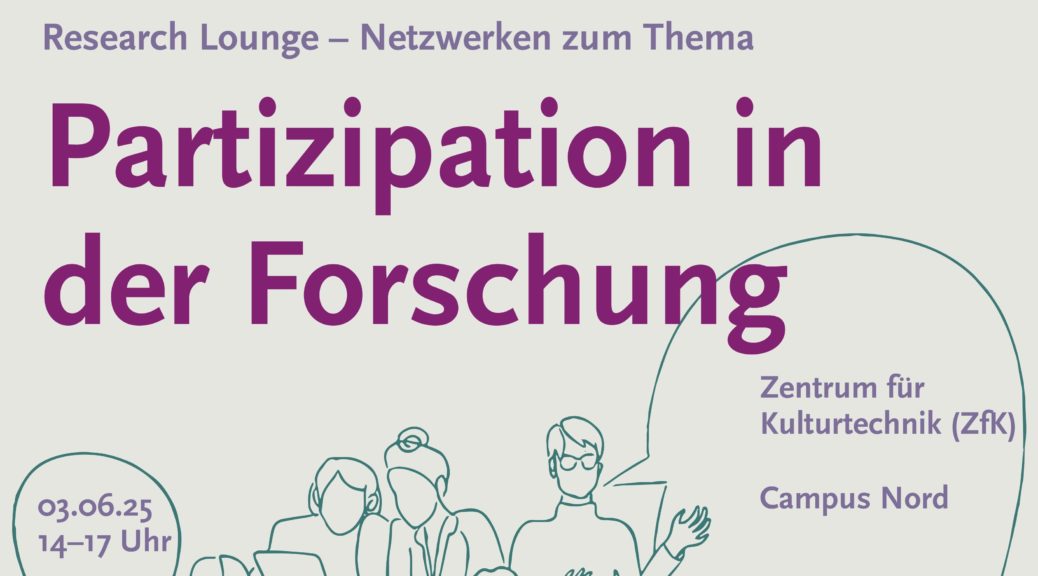Ringvorlesung „Beziehungsweise Familie“ – am 02. Juli 2025 mit Erdmute Alber
Lernen und Lehren mit der Gesellschaft: Ausschreibung
Für Förderung von Seminaren in Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren bis zum 30.07.2025 bewerben.
Das Programm „Lernen und Lehren mit der Gesellschaft: transdisziplinäres Kursprogramm im Objektlabor“ unterstützt Lehrende und Studierende fachübergreifend dabei, wissenschaftliche Fragen und Seminararbeit in Kooperation mit der Gesellschaft zu gestalten. Ziel ist es, Fragen, Erfahrung und Wissen aus der Gesellschaft in die Lehre und universitäre Arbeit mit Studierenden zu integrieren, von den unterschiedlichen Akteur:innen der Zivilgesellschaft, Kultur oder Politik zu lernen und einen gleichberechtigten Austausch zu erproben.
Dazu fördert das Kompetenzfeld für „Wissensaustausch mit der Gesellschaft“ am Zentrum für Kulturtechnik bis zu 5 Seminare, die transdisziplinär oder partizipativ arbeiten und Elemente des Austauschs mit der Gesellschaft oder Public Engagement beinhalten. Hierzu kann gehören:
- Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren / Organisationen
- Kooperation in der Organisation oder Präsentation von Kursinhalten; als Co-Teaching oder Verwendung anderer Methoden, die eine Aufnahme von Expertise aus der Gesellschaft zum Ziel haben
- Kursgestaltung mit Aspekten des Community-based Research/Learning
- Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren innerhalb eines Seminars durch Studierende, in Kursprojekten oder Abschlussarbeiten
- Kooperationen mit gesellschaftlichen Gruppen oder Organisationen für Darstellung/Ausspielung der Kursergebnisse
- Kurse, die materielle Praktiken, Sammlungsarbeit, Objekt- oder körperzentrierte Zugänge in der Lehre mit externen Kooperationen verbinden
Förderung durch:
- Kursmittel bis zu 1.000 Euro pro Seminar (im Rahmen der Ausgabe- und Vergaberegelungen der HU)
- Nutzung des Raums „Objektlabor“ auf dem Campus Nord, inkl. der flexiblen Raumausstattung, Technik
- gelegentliche Veranstaltungsassistenz nach Absprache
- Unterstützung/Beratung durch HU Team Wissensaustausch mit der Gesellschaft (ca. 2h pro Woche)
Förderfähig sind:
- BA oder MA- Lehrveranstaltungen der HU Berlin im WiSe 2025/26
- Seminare, die im Objektlabor am Campus Nord stattfinden können oder einen räumlichen Bezug zum Raum durch Workshops/Teile der Seminararbeiten herstellen
- Kursmittel, die als Sachmittel und im Kalenderjahr 2025 ausgegeben werden (Ausgaben werden durch Zentrum für Kulturtechnik bzw. das zugeordnete PSP-Element bezahlt)
Antragsprozess:
Seminarleiter*innen und Lehrende sind eingeladen, eine Anfrage mit folgenden Bestandteilen bis 30.07.2025 für das Wintersemester 2025/26 an wissensaustausch.hzk@hu-berlin.de zu senden:
- kurze Kursbeschreibung,
- Motivation für und Beschreibung der transdisziplinären/partizipativen Zusammenarbeit mit externen gesellschaftlichen Akteuren/Organisationen,
- kurze Budget-Skizze mit voraussichtlichen Ausgaben/Bedarfen,
- Skizzierung der benötigten Kurs-/Veranstaltungs-/Objektbetreuung
Kontakt:
Xenia Muth / Leonie Kubigsteltig
Kompetenzfeld Wissensaustausch mit der Gesellschaft
E-Mail: wissensaustausch.hzk@hu-berlin.de
Tel: +49(0)30 2093-12892 | -12881
Research Lounge „Partizipation in der Forschung“ am 3. Juni 2025
Die Research Lounge zum Thema „Partizipation in der Forschung” findet am Dienstag, 3. Juni 2025 von 14 bis 17 Uhr am Zentralinstitut Zentrum für Kulturtechnik (ZfK), Campus Nord, statt. Organisiert vom Team des Vizepräsidenten Forschung in Kooperation mit dem Kompetenzfeld „Wissensaustausch mit der Gesellschaft“ sind Wissenschaftler:innen der Humboldt-Universität und ihrer Partnereinrichtungen bei dieser Research Lounge zur Vernetzung eingeladen: Anmeldung hier
Wissensaustausch mit der Gesellschaft wird durch partizipative und transdisziplinäre Ansätze zunehmend zu einem wichtigen Teil der Wissensproduktion in der Forschung. Während diese Ansätze in manchen Forschungsbereichen wie Nachhaltigkeits- und Innovationsforschung zum Standard gehören, gibt es in anderen Fachbereichen dazu weniger Erfahrungen und Austausch. Dabei gelten, neben anderen Forschungsmodi, partizipative und transdisziplinäre Forschungsmethoden als eine besonders gute Möglichkeit, innovative Lösungen zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen. Dazu können durch Kooperationen mit Bürger:innen, der organisierten Zivilgesellschaft, Kultur oder Politik neue Forschungsthemen erschlossen sowie durch deren aktive Teilnahme Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt werden.
Für partizipative Ansätze in der Forschung gibt es eine Vielzahl an Definitionen, Methoden und Erfahrungen sowie eine hohe Diversität der beteiligten Akteur:innen und Formen von Partizipation. Daher hat die Research Lounge “Partizipation in der Forschung” zum Ziel, den wissenschaftlichen Austausch und die Vernetzung in diesem Bereich zu fördern und die Vielfalt aktueller Forschungsaktivitäten und Erfolgsbeispiele an der Humboldt-Universität zu beleuchten.
Programm
14:00 Uhr – Begrüßung
Prof. Dr. Christoph Schneider (Vizepräsident für Forschung)
Xenia Muth, Leonie Kubigsteltig, Zentrum für Kulturtechnik
14:20 Uhr – Impulsvorträge
Dr. Saskia Schäfer (Institut für Asien- und Afrikawissenschaften):
Participatory research on democracy: Insights from civic education and local decision-making
Dr. Silke Stöber (Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften):
Participatory action research for food systems transformations: methods and challenges
Prof. Dr. Regina Römhild (Institut für Europäische Ethnologie):
Postcolonial Neighborhoods: A new experiment in collective ethnography and trans-academic collaboration
Prof. Dr. Elisabeth Verhoeven (Institut für deutsche Sprache und Linguistik):
Sprachen Berlins – Languages of Berlin: mapping the city’s linguistic diversity
Prof. Dr. Miriam Bouzouita (Institut für Romanistik):
Using Citizen Science to examine geospatial and sociolinguistic variation and change
Pause
Prof. Dr. Robert Arlinghaus (Integratives Fischereimanagement, IGB, IRI THESys):
Ko-Produktion von Wissen in Partizipation verändert Einstellungen, Normen und Haltungen von Praktiker:innen: Beispiele aus der Fischereiforschung
Prof. Dr. Heike Wiese (Institut für deutsche Sprache und Linguistik):
Mehrsprachigkeit gemeinsam gestalten: Partizipative Forschung mit Berliner Schüler:innen und Studierenden der HU
Dr. Constanze Saunders (Professional School of Education):
„Lernende Schulen und forschende Lehrkräftebildung“
Indrawan Prabaharyaka (Institut für Europäische Ethnologie):
Animation and Prototyping: Two transdisciplinary tools for knowledge exchange with more-than-human society
Dr. Stefanie Alisch (Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft):
Von Reasoning Sessions und Dubdampfer – Sound System Epistemologies vernetzt in Berlin
16:30 Uhr – Offenes Netzwerken
Um Anmeldung wird gebeten: für die Research Lounge hier anmelden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstaltung.
Ringvorlesung „Beziehungsweise Familie“ – am 28. Mai 2025 mit Aparecida Vilaça
Vergangene Zukünfte
Di., 10. Juni, 12:30-16:30
Ein Workshop zu Visualisierungen von Infrastrukturvisionen in Geschichte und Gegenwart
In den letzten hundert Jahren hat Berlin eine Reihe von Krisen erlebt, die die Stadt, ihre Bevölkerung und ihre Infrastrukturplaner*innen vor große Herausforderungen gestellt haben. Welche stadttechnischen Zukunftsvisionen wurden zur Bewältigung von Krisenerscheinungen in der turbulenten Geschichte Berlins entwickelt? Welche Nachwirkungen hatten diese historischen Zukunftsvisionen? Welche Anregungen können wir daraus für heutige Zukunftspläne ziehen? Anhand von inspirierendem Bildmaterial aus den Archiven lernen wir einige dieser visionären Vorschläge zur Stärkung der infrastrukturellen Resilienz der Stadt kennen. Ausgehend von diesen Visualisierungen diskutieren wir, welche Ziele mit diesen Visionen verfolgt wurden, was aus ihnen geworden ist und wie sie heute noch wirken. In Zusammenarbeit mit Expert*innen aus den Bereichen Spekulation, Kunst und Wissenschaftskommunikation werden wir diese Visionen auf neuartiger Weise aktivieren, um aktuelle Herausforderungen der Hauptstadt zu reflektieren und darauf zu reagieren.
Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen des DFG-Projekts Past-proofing Infrastructure Futures am IRI THESys, Humboldt-Universität zu Berlin
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pauline Münch pauline.muench@hu-berlin.de.
Ort: Objektlabor
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
Humboldt-Universität zu Berlin
Campus Nord – Haus 3
Philippstr. 13
Ringvorlesung „Beziehungsweise Familie“ – am 14. Mai 2025 mit Janet Carsten
Neuer Kurztitel & neues Logo: ZfK – Zentrum für Kulturtechnik
Am Beginn des Hermann von Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik stand „Bild – Schrift – Zahl“, vertreten unter anderem durch prominente Denker wie Horst Bredekamp (Kunstgeschichte), Jochen Brüning (Mathematik) und Friedrich Kittler (Kulturwissenschaft). Durch den konsequenten Fokus auf die Medialität und materielle Gebundenheit von Wissen wurde ein innovativer Blick auf unterschiedlichste interdisziplinäre Zusammenhänge möglich. In einer zweiten Phase rückte die Materialität in ihrer ästhetischen Form noch stärker in den Vordergrund und erlaubte auf Gestaltungs- wie auf Sammlungsebene neuartige Formen der Wissensanalyse. Seit 2021 wird diese Analyse erweitert und ergänzt durch sozialanthropologische Perspektiven sowie Fragen der Wissensvermittlung als genuinen Schauplätzen von inter- und transdisziplinärer Wissensproduktion.
Seit dem Frühjahr 2025 freuen sich die Mitglieder des Hermann von Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik über einen neuen Kurztitel: Zentrum für Kulturtechnik. Die neue Abkürzung – ZfK – findet sich auch im neuen Logo.
Das neue Logo vereint die drei Phasen: Ästhetisch-visuell an lateinischen Buchstaben orientiert, lässt es sich als Abkürzung für „Zentrum für Kulturtechnik“ lesen. Tatsächlich sind die Zeichen jedoch dem Unicode entnommen, d.h. dem paradoxen Versuch, die Vielfalt der mehr als 110.000 Schriften dieser Welt in einem Code zu vereinen, ohne dadurch eine semantische Einheit zu bilden. Das Logo fasst damit die Herausforderung des Umgangs mit irreduzibel diversem Wissen in ein Bild, das gleichermaßen lesbar wie unlesbar ist: das Z ist zugleich ein mathematisches Zeichen, das f ist der mongolischen Phagba-Schrift und das K der antiken lykischen Sprache entnommen. Als einzelne Zeichen sind sie weder willkürlich noch lassen sie sich in ein geschlossenes Sinnsystem bringen. Jede Verwendung ist potenziell ein angreifbares Argument. Die reflexive Paradoxität ist programmatisch für die Arbeit an und mit Kulturtechniken, verstanden als Medien der Distanznahme, durch die Verständnis erst möglich wird. Auf dieser Basis erprobt ZfK das Zusammenwirken von material- und sammlungsbasierter Forschung, der Öffnung disziplinär geprägter Epistemologien und der Third Mission: Wissensaustausch mit der Gesellschaft und Vermittlung als dritte Säule der Universität.
[Text: Prof. Daniel Tyradellis]
Ringvorlesung „Beziehung Familie“ – Sommerzyklus 2025
Lernen und Lehren mit der Gesellschaft: Seminare im SoSe 2025 im Objektlabor gestartet
Ein neues Seed Funding Programm des Kompetenzfelds Wissensaustausch mit der Gesellschaft unterstützt transdisziplinär durchgeführte Seminare im Objektlabor finanziell und inhaltlich dabei, wissenschaftliche Fragen und Seminararbeit in Kooperation mit der Gesellschaft zu gestalten.
Im Zentrum der Seminare im Sommersemester 2025 steht die Auseinandersetzung mit Archiven, Sammlungen, Medien- oder Kunstobjekten als Träger historischer, politischer und ästhetischer Bedeutungen und Fragen der Darstellung oder auch des Verbergens. Durch forschungsorientierte, kuratorische und künstlerisch-praktische Zugänge experimentieren fünf Seminare mit Praktiken des Sichtbarmachens, Löschens, Transformierens und Neudenkens.
„Overloaded! Inter-Imperiale Verflechtungen von Materiellen und Fotografischen Sammlungen in Berlin und Wien“ (Café Interimperial)
Prof. Dr. Magdalena Buchczyk (Institut für Europäische Ethnologie), Dr. Hanin Hannouch (Weltmuseum Wien) und Anna Szöke (Ethnologisches Museum/Asian Art Museum)
Das Café Interimperial ist eine öffentliche, von Studierenden organisierte Veranstaltung, die im Rahmen des MA-Seminars Overloaded! Inter-imperial Entanglements of Material and Photographic Collections in Berlin and Vienna (Institut für Europäische Ethnologie) stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem Weltmuseum Wien und dem Ethnologischen Museum Berlin beschäftigen sich die Studierenden des Seminars mit den inter-imperialen Beziehungen, die sich in den Sammlungen von Fotografie und der materiellen Kultur in beiden Städten widerspiegeln. Das Café Interimperial verwandelt das Objektlabor für einen Tag in einen Pop-up-Raum für Austausch und Einblicke in die laufenden Forschungsprojekte der Studierenden. Die Veranstaltung lädt Wissenschaftler*innen und die interessierte Öffentlichkeit dazu ein, mit den Arbeiten der Studierenden, die die vielschichtige Geschichte verschiedener Objekte und Bilder Berlins und Wiens beleuchten, in einen Dialog zu treten. (Seminar auf Deutsch und Englisch)
Café Interimperial:
- Wann: Dienstag, 8. Juli, von 14:30 bis 18:00 Uhr
- Wo: Objektlabor, Zentrum für Kulturtechnik,
HU Berlin, Campus Nord, Haus 3,
Phillipstraße 13, 10115 Berlin (Hinweise zur Anfahrt) - Zur Verpflegung stehen Kaffee und eine Auswahl an tollen Kuchen bereit.
- Bei Interesse bitten wir um eine kurze Voranmeldung an: wissensaustausch.hzk@hu-berlin.de.
„Öffentlichkeit und Zensur. Zur materiellen Kultur von Bild- und Sprechverboten“
Dr. Katja Müller-Helle (Das Technische Bild, Institut für Kunst- und Bildgeschichte) und Dr. Alia Rayyan (Theorie und Praxis des Kuratierens, Zentrum für Kulturtechnik)
Die praxisorientierte Übung wirft einen historisch-systematischen Blick auf die Begriffe von Öffentlichkeit und Zensur und auf die spezifisch materiellen Praktiken ihrer kontextabhängigen Umsetzung: Blurring-Effekte, schwarze Balken, Überblendungen und Übermalungen reichen tief in die Debattengeschichte von Inhaltsregulierung hinein und sind gleichzeitig hoch aktuell und in ständiger Transformation. Der Kunstraum nimmt hinsichtlich des Umgangs, der Rahmensetzung oder Ausweitung des Sag- und Zeigbaren eine Sonderstellung ein: Er kann als Experimentierfeld verstanden werden, durch das Praktiken der Zensur umgangen, erweitert, überschrieben oder auch eingefordert werden. Hengame Hosseini, eine Künstlerin aus Teheran, deren Arbeit aus der gelebten Erfahrung innerhalb des soziopolitischen Kontexts im Iran heraus entsteht, wird das Seminar mitgestalten. Aus ihrer Perspektive als beobachtende Zeitzeugin spricht sie über öffentliche Räume, Sichtbarkeit und die visuelle Sprache des Widerstands – etwa im Rahmen der Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘, in der sich die Straße als Ort eines fortlaufenden Dialogs zwischen Repression und Ausdruck manifestierte. (Seminar auf Deutsch)
„Die Werkstatt der Kulturen archivieren: (post)migrantische Geschichten in den Künsten Berlins“
Dr. Habiba Hakimuddin Insaf (Institut für Kunst und Bildgeschichte) und Juana Awad (inherit.heritage in transformation)
Die Werkstatt der Kulturen (WdK) in Berlin war von 1993 bis 2019 die einzige staatlich geförderte Einrichtung der Stadt, die sich der Präsentation von Kunst und Kultur migrantischer Akteur*innen und Schwarzen und POC (People of Colour) Communities widmete. Mit Formaten wie Festivals, Konzerten, Filmvorführungen, Workshops und transnationalen Kooperationen bot sie eine Plattform für künstlerische Experimente für Einzelpersonen und Gruppen, die von anderen staatlich geförderten Kulturräumen in der Stadt weitgehend ausgeschlossen waren. Nach der Schließung durch den Berliner Senat hinterließ die WdK umfassendes Archivmaterial, das heute 205 Kisten mit offizieller Korrespondenz, Fotos, Videos, Flyern usw. umfasst und die Arbeit von dreißig Jahren (post)migrantischer Kunst- und Kulturpräsentation in der Stadt dokumentiert. Das Seminar untersucht die Materialien in Zusammenarbeit mit dem treuhänderischen Verwalter der Archivsammlung, dem Migrationsrat Berlin e.V. als lokalem gesellschaftlichen Akteur. Anhand von Schlüsselfragen zu den Begriffen Archivierung und Präsentation erstellen die Teilnehmer*innen ein Grobverzeichnis der Archivsammlung und recherchieren und kuratieren Beispiele für die öffentliche Präsentation in Form einer virtuellen Ausstellung. (Seminar auf Deutsch und Englisch)
„Meet the Sponges: Curating Dark Ecology, Deep Immersion, Shifting Senses and Other Relationality“
Felix Sattler (Kurator des Tieranatomischen Theaters, Zentrum für Kulturtechnik)
MEET THE SPONGES erprobt kuratorische Strategien für eine neue Zugänglichkeit von Universitätssammlungen. Es integriert dabei u.a. Methoden aus der multimodalen Anthropologie und der künstlerischen, praxisbasierten Forschung. Das Seminar arbeitet mit dem sogenannten Tiefseekabinett, das mikroskopische historische Präparate von Glasschwämmen aus der Zoologischen Lehrsammlung der HU enthält. Die Teilnehmer*innen des Projekts experimentieren mit der Etablierung einer neuen Beziehungsästhetik und -ethik zwischen Lebensformen der Tiefsee und Menschen. Das Seminar wird gerahmt durch die Diskussion von naturkundlichen Berichten und theoretischen Positionen aus den Curatorial Studies, Material Culture Studies, Science and Technology Studies (STS), Öko- und Hydrofeminismus. Als Ergebnisse des Seminars werden Prototypen für eine Ausstellung von Studierenden im Austausch mit akademischen und gesellschaftlichen Akteuren vorbereitet. (Seminar auf Englisch)
“Lehrveranstaltung des Menzel-Dachs mit Matt Saunders: Remediations“
Dr. Jakob Schillinger (Menzel-Dach, Institut für Kunst- und Bildgeschichte) und Matt Saunders (Department of Art, Film and Visual Studies, Harvard University)
Ausgehend von Matt Saunders‘ eigener künstlerischer Praxis untersucht diese praxisorientierte Lehrveranstaltung Prozesse der „Remediation“ und des Transfers zwischen verschiedenen Medien. Ausgehend von der Malerei geht Saunders‘ Werk poröse und provokative Beziehungen zu anderen künstlerischen Formen ein, insbesondere zu Fotografie, Druckgrafik und Installation von Animationsfilmen. Um verschiedene Praktiken miteinander zu verknüpfen, umfasst der Kurs die Zusammenarbeit mit dem Steindrucker Ulrich Kühle. Dieser Ansatz des Maker-zentriertes Lernens und Lehrens wird von Matt Saunders, dem Zentrum für Kulturtechnik und dem Menzel-Dach, das demnächst als Ort für die Erkundung von künstlerischer Praxis in Forschung und Lehre wiedereröffnet wird, geteilt. (Seminar auf Englisch)
Kontakt:
Bei Fragen zum Progamm wenden Sie sich gerne an
Xenia Muth
Leonie Kubigsteltig
Kompetenzfeld Wissensaustausch mit der Gesellschaft
Tel: +49(0)30 2093-12892 | -12881
Email: wissensaustausch.hzk@hu-berlin.de