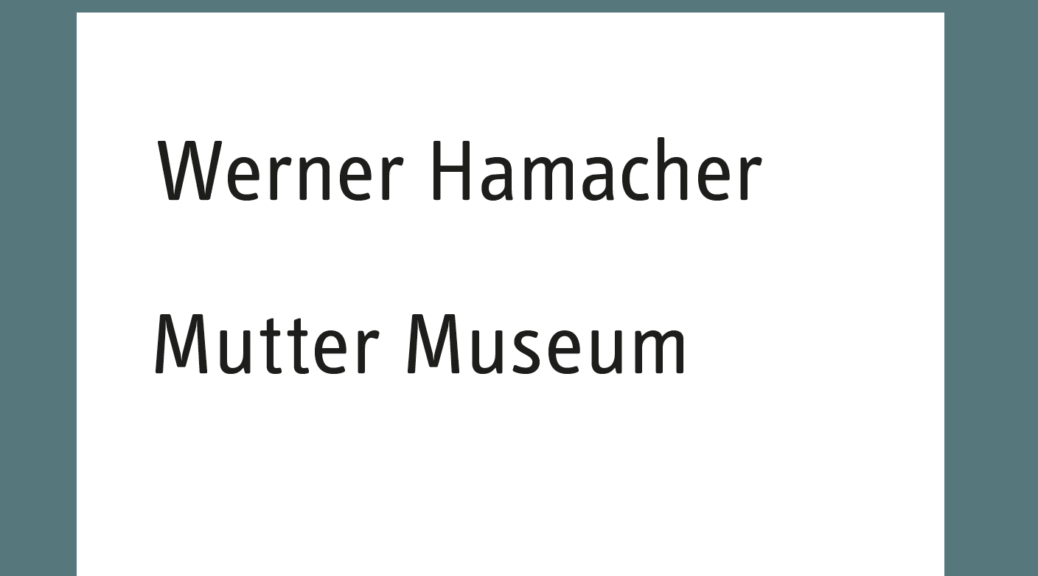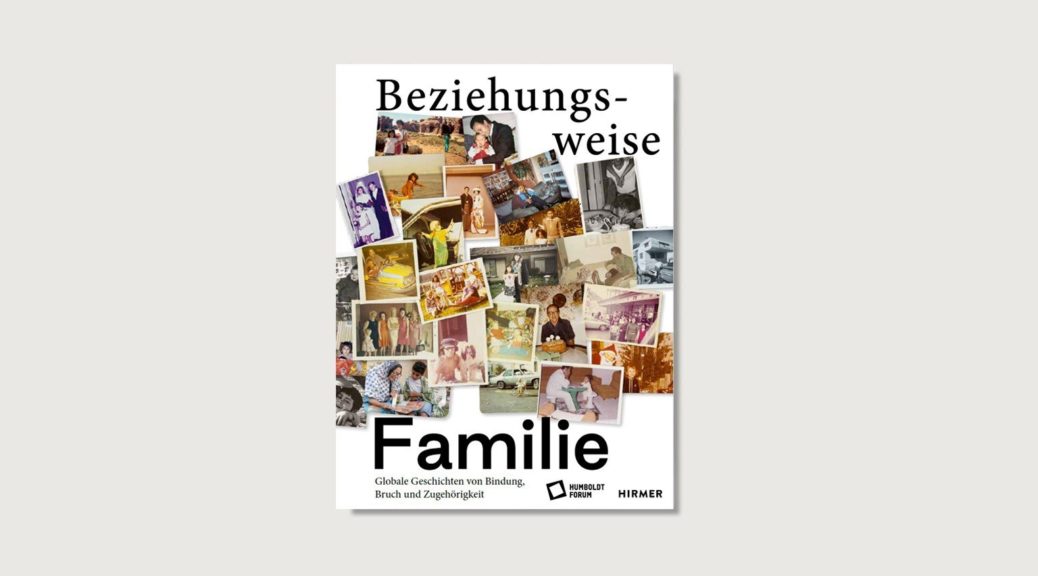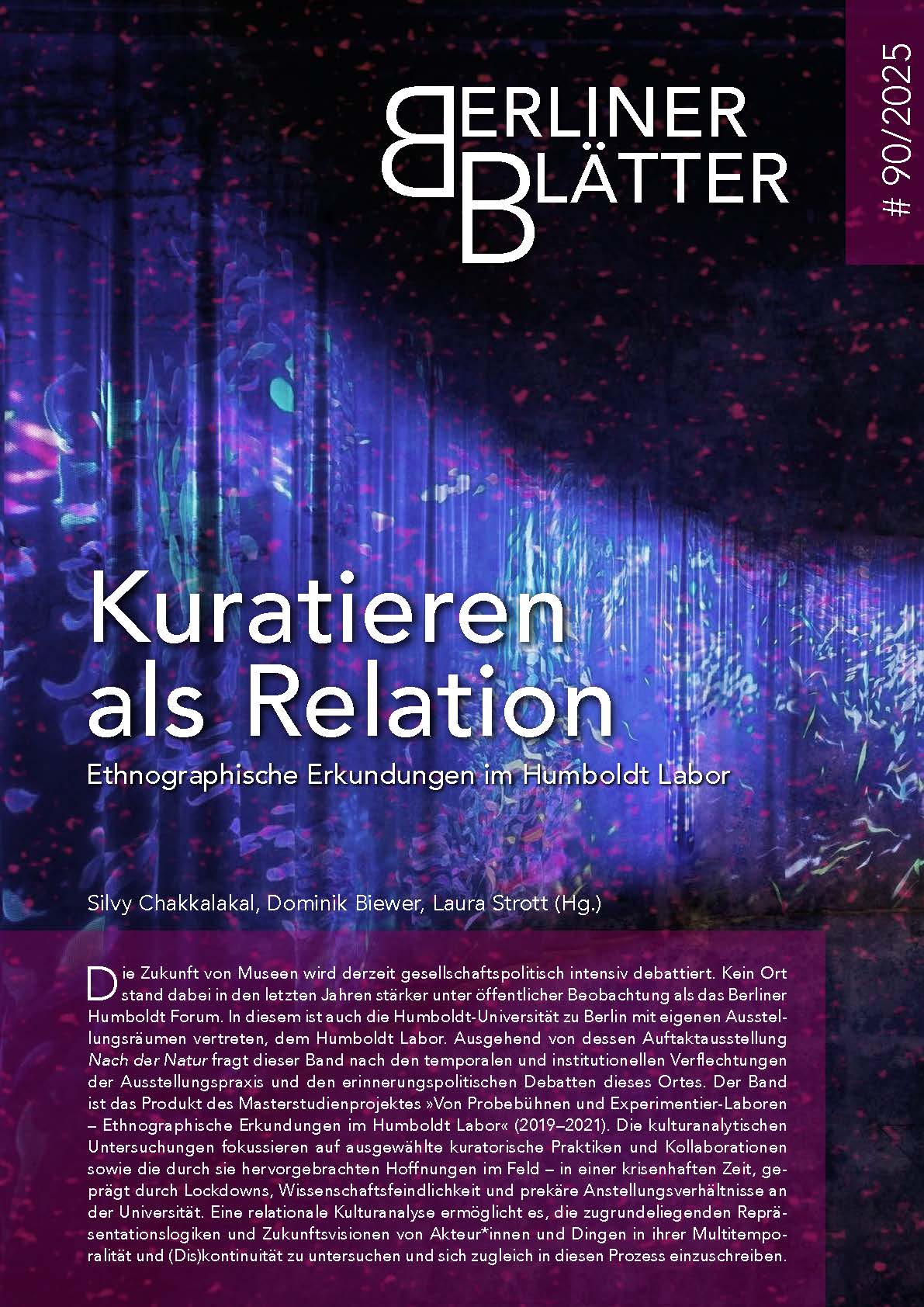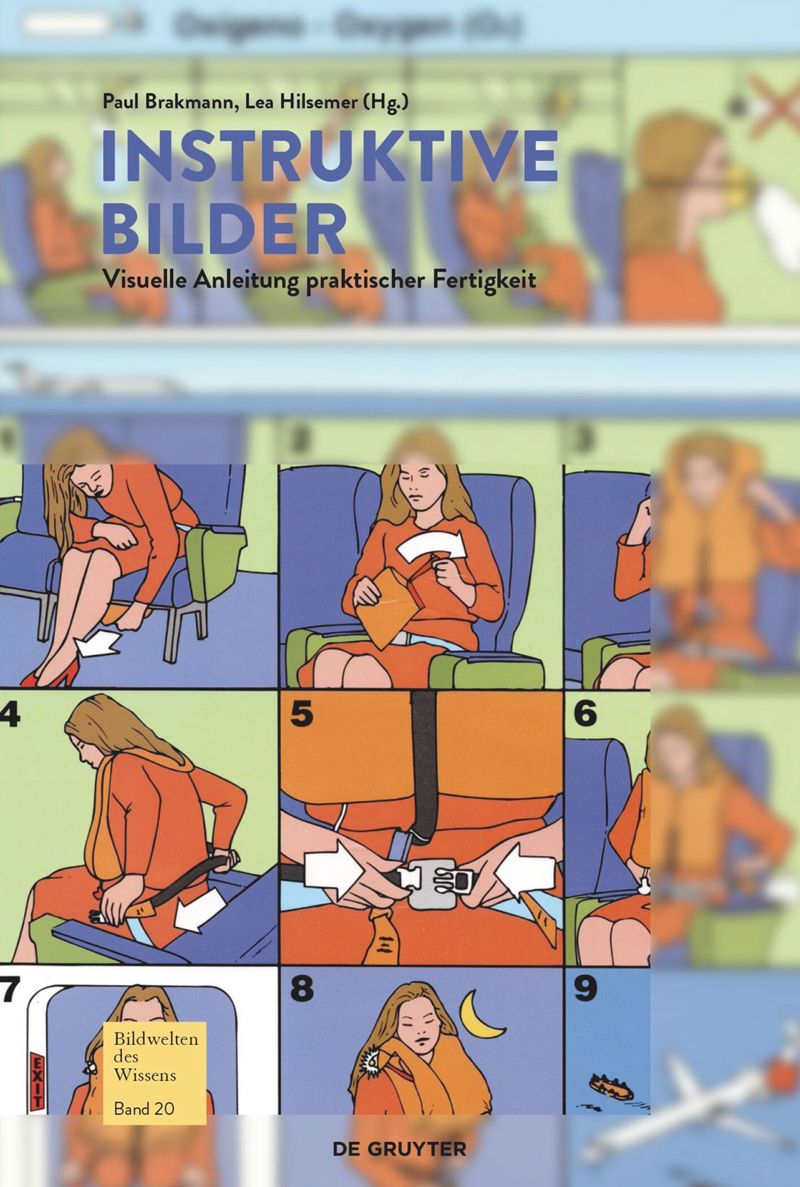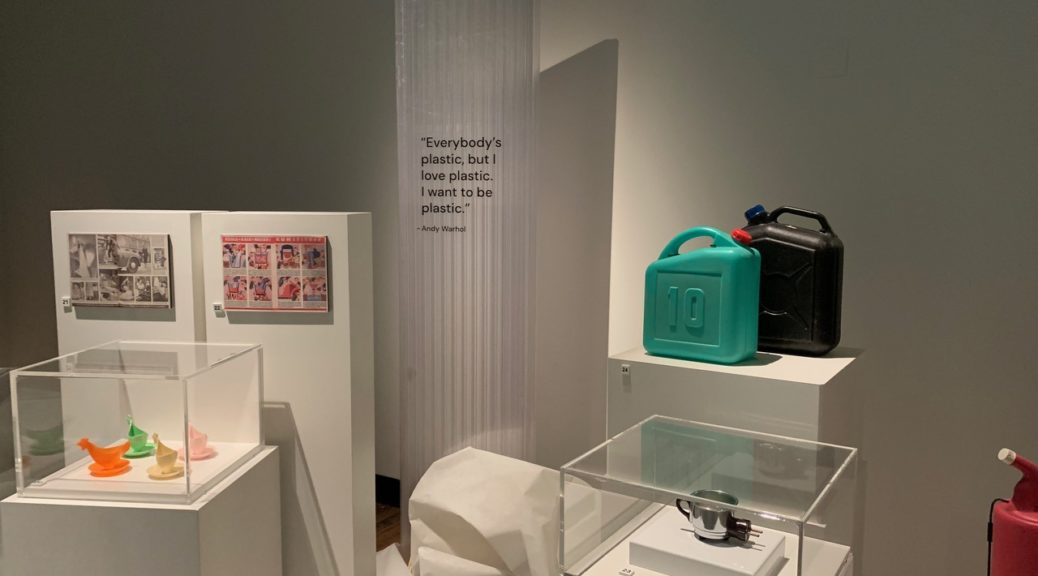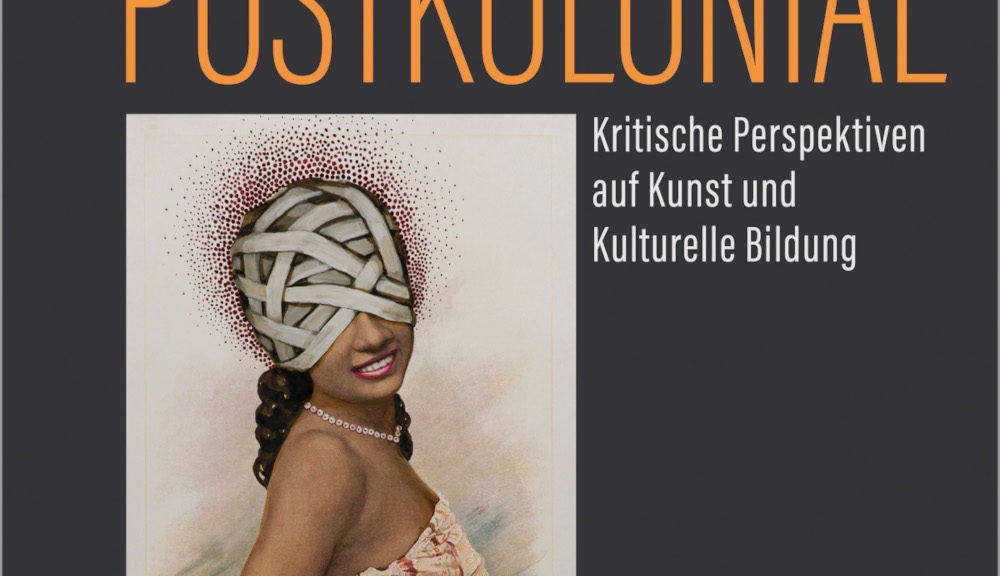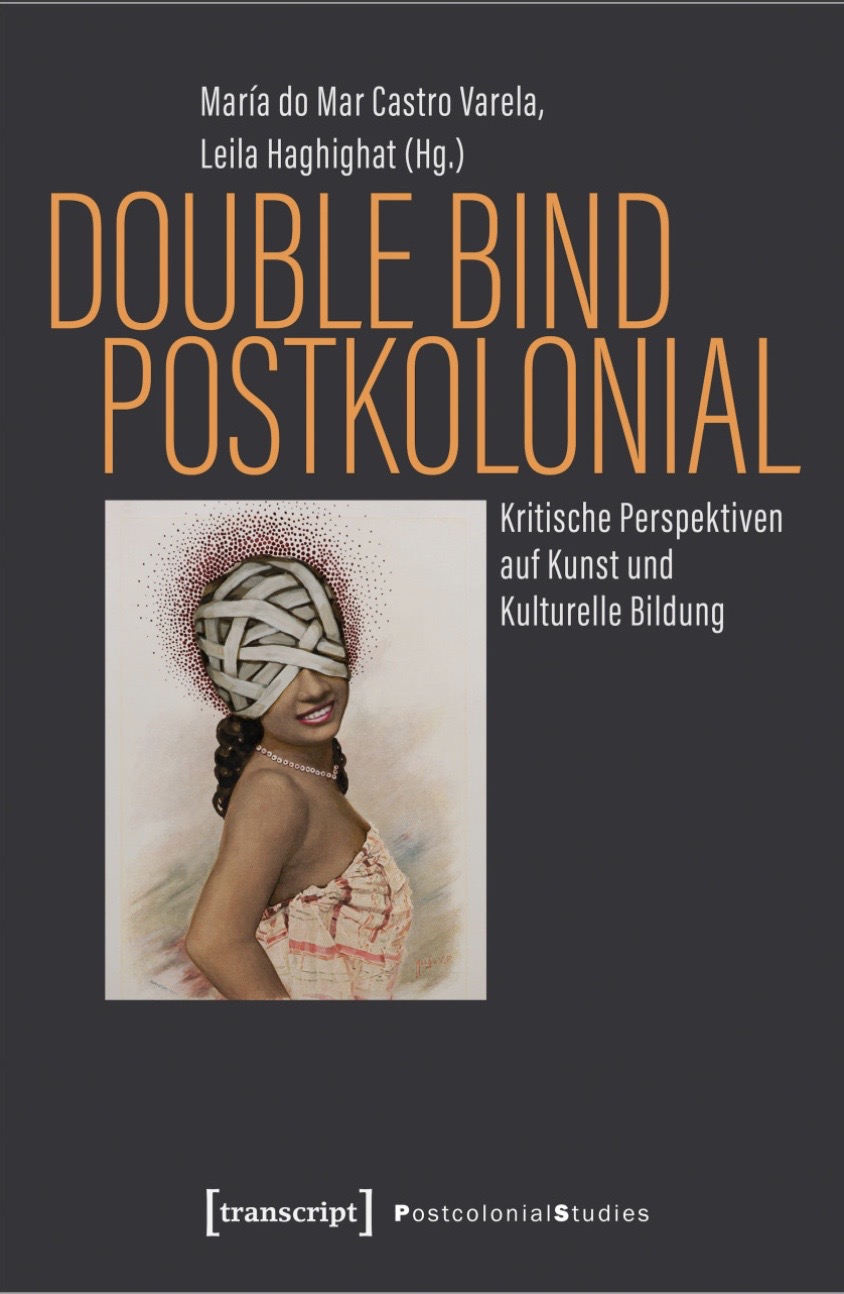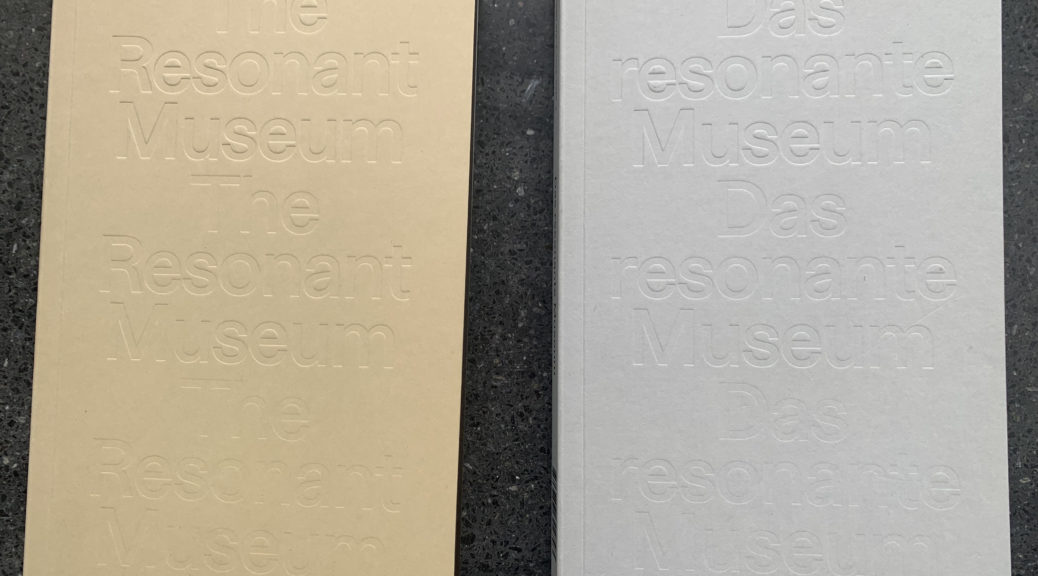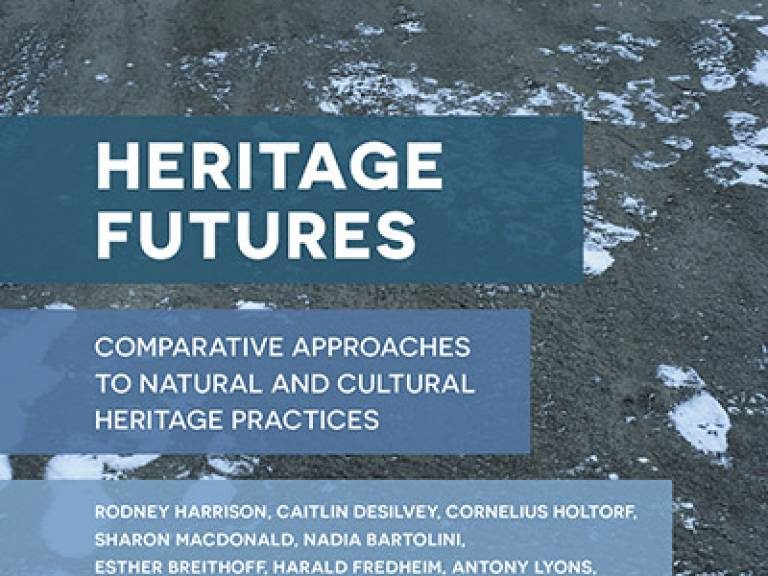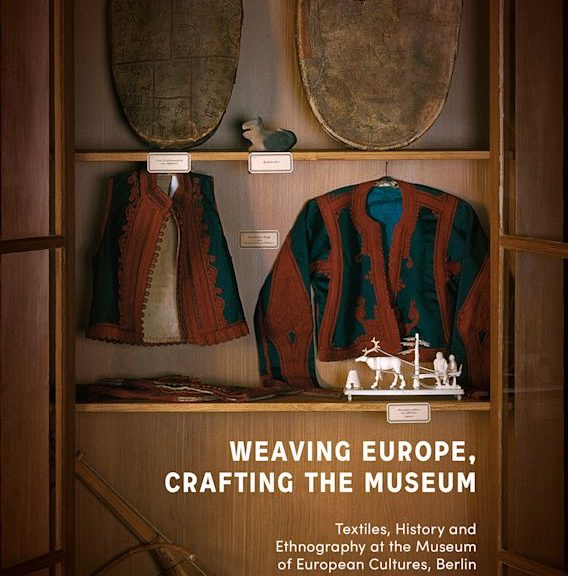Unearthing Collections ist ein neuer Band, der von Magdalena Buchczyk (IfEE), Martín Fonck, Tomás Usón und Tina Palaić gemeinsam herausgegeben und von UCL Press veröffentlicht wurde.
Das Buch ist vollständig im Open Access verfügbar und kann hier abgerufen werden.
Unearthing Collections lädt die Leser dazu ein, die Ethik von Sammlungen und Archiven aus der Perspektive der Zeit zu überdenken. Von Protesten der Bevölkerung gegen Gletscherproben bis hin zu ethischen Dilemmata rund um menschliche Überreste und politische Kunst untersuchen die Autoren die Herausforderungen des Sammelns, Ausstellens und Bewahrens von Spuren.
Im Mittelpunkt des Buches steht das Konzept des „Ausgrabens“ – das Aufdecken verborgener Wahrheiten, das Freilegen von Schichten der Geschichte und das ans Licht bringen des Unbekannten. Es befasst sich damit, wie das Streben nach Wissen oft mit Kosten verbunden ist, darunter Vertreibung, Ausbeutung, Kommodifizierung und das bleibende Erbe von Imperialismus und Kolonialismus.
Neben der Kritik an den extraktiven Praktiken, die viele Sammlungen und Archive geprägt haben, stellt das Buch das „Re-Earthing” vor – eine Praxis, die unser Verständnis von Spuren der Vergangenheit und unseren Umgang mit ihnen neu gestaltet. Als kritischer Ansatz erkennt „Re-Earthing“ die chaotische, verflochtene Natur dieser Spuren an und widersetzt sich Versuchen, sie zu kontrollieren oder zu bereinigen, sodass sie sich zu neuen Formen des Wissens entwickeln können. Diese Perspektive ermutigt Wissenschaftler, Archivare, Künstler und Sammler, Zeit und Spuren zu überdenken, vorherrschende Chronologien in Frage zu stellen und ethischere Arbeitsweisen mit Sammlungen und Archiven zu entwickeln.
Das Buch wird begleitet vom „Practising Collection Ethics Toolkit“ – einer praktischen Ressource, die Museums- und Archivfachleute bei der Bewältigung ethischer Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Sammlungen unterstützen soll.
Diese Publikationen basieren auf der Arbeit von TRACTS COST Action, unterstützt von der COST Association – European Cooperation in Science and Technology.