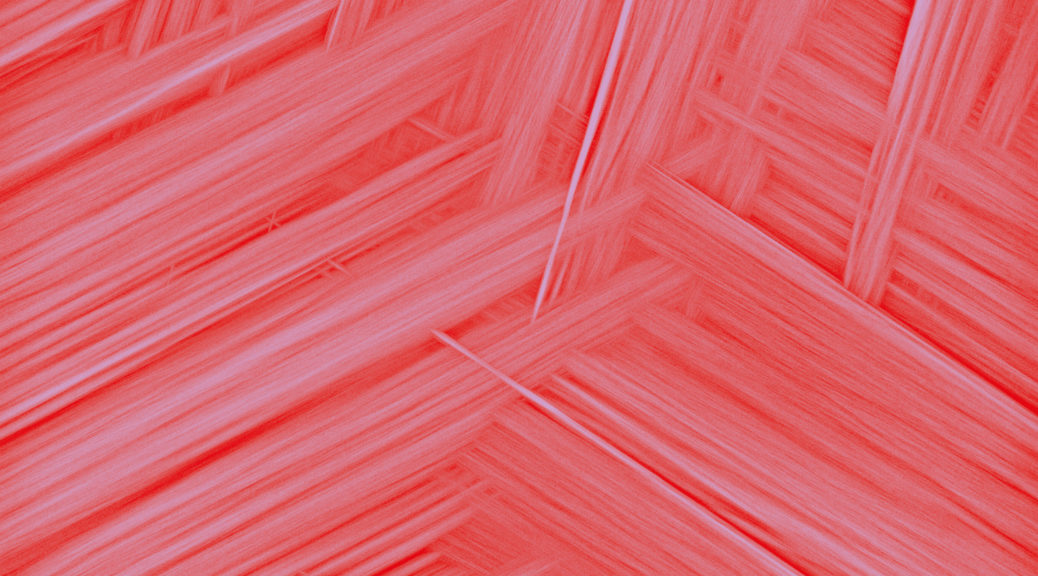Am Freitag, den 13. Februar 2026, begrüßten wir Kolleginnen der Lund University im Gerlachbau und im Humboldt Labor. Nachdem unsere Gäste auf der Suche nach dem richtigen Eingang bereits einen ersten Eindruck vom Campus gewinnen konnten, starteten wir gegen 9:15 Uhr mit dem fachlichen Austausch im Objektlabor.
Sammlungen in Forschung, Lehre und Transfer
Im Mittelpunkt standen die Universitätssammlungen – ihre Administration, Vernetzung und insbesondere ihr Einsatz in der Lehre. Sarah Elena Link stellte die Koordinierungsstelle vor, Nina El Laban Devauton und Martin Stricker präsentierten das Projekt „Teaching with Objects“, und Oliver Zauzig berichtete über seine Arbeit als zentraler Sammlungskoordinator der HU.
Die Kolleginnen aus Lund gaben Einblicke in aktuelle Entwicklungen an ihrer Universität, insbesondere in Bezug auf Forschung, Lehre und den Transfer in die Gesellschaft. Dabei wurden zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber auch strukturelle Unterschiede deutlich. Besonders sichtbar wurde, dass wir mit der Koordinierungsstelle und dem umfangreichen Sammlungsnetzwerk in Deutschland ein viel beachtetes Modell etabliert haben, das auch international auf Interesse stößt.
Austausch im Netzwerk
Da großes Interesse an der Berlin University Alliance und dem Berliner Sammlungsnetzwerk bestand, besichtigten wir u.a. vor der Mittagspause die anatomische Sammlung der Charité – derzeit die einzige frei zugängliche Sammlung auf dem Campus Nord.
Am Nachmittag folgte der Besuch der Ausstellung „On Water. WasserWissen in Berlin“ im Humboldt Labor. Anna-Lisa Dieter führte durch die Ausstellung, anschließend diskutierten wir im Seminarraum gemeinsam weiter; auch Sharon Macdonald nahm daran teil. Unsere Gäste zeigten sich beeindruckt von den Möglichkeiten, die sich der HU mit dem Humboldt Labor eröffnen.
Nachhaltige Impulse
Der Besuch unterstrich, dass die HU mit ihren Sammlungen und Bühnen Maßstäbe setzt – zugleich wurde deutlich, dass hierfür verlässliche Ressourcen notwendig sind. Alle Beteiligten nahmen wertvolle Impulse für die eigene Arbeit mit. Der Austausch soll fortgesetzt werden, denn auch die HU profitiert von der weiteren Stärkung des europäischen Netzwerks.
Teilnehmende aus Lund:
Sara Virkelyst (zentrale Ansprechpartnerin für Museen und Archive), Charlotta Sokulski Bateld (Koordinatorin Kulturforum für Kunst und Wissenschaft), Louice Cardell Hepp (Kommunikation Kulturforum), Frida Stenmark (Museumskoordinator am Museum für künstlerische Prozesse und öffentliche Kunst) sowie Anki Wallengren (Prorektorin für Kultur und pädagogische Entwicklung).
Von Seiten des ZfK:
Sarah Elena Link, Nina El Laban Devauton, Martin Stricker, Anna-Lisa Dieter, Sharon Macdonald und Oliver Zauzig.
Dank an Xenia Muth und Eileen Klingner für die Unterstützung.