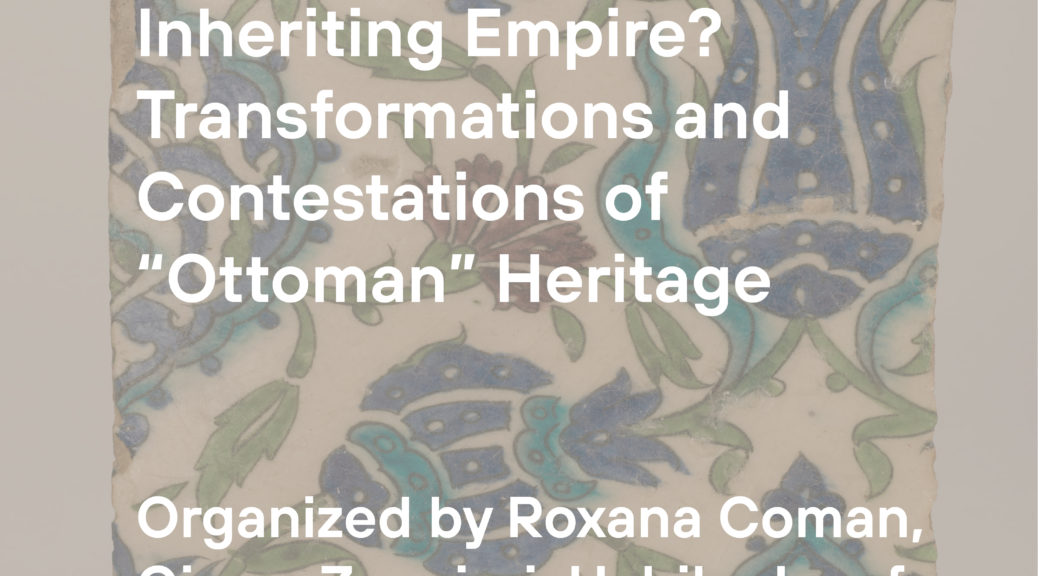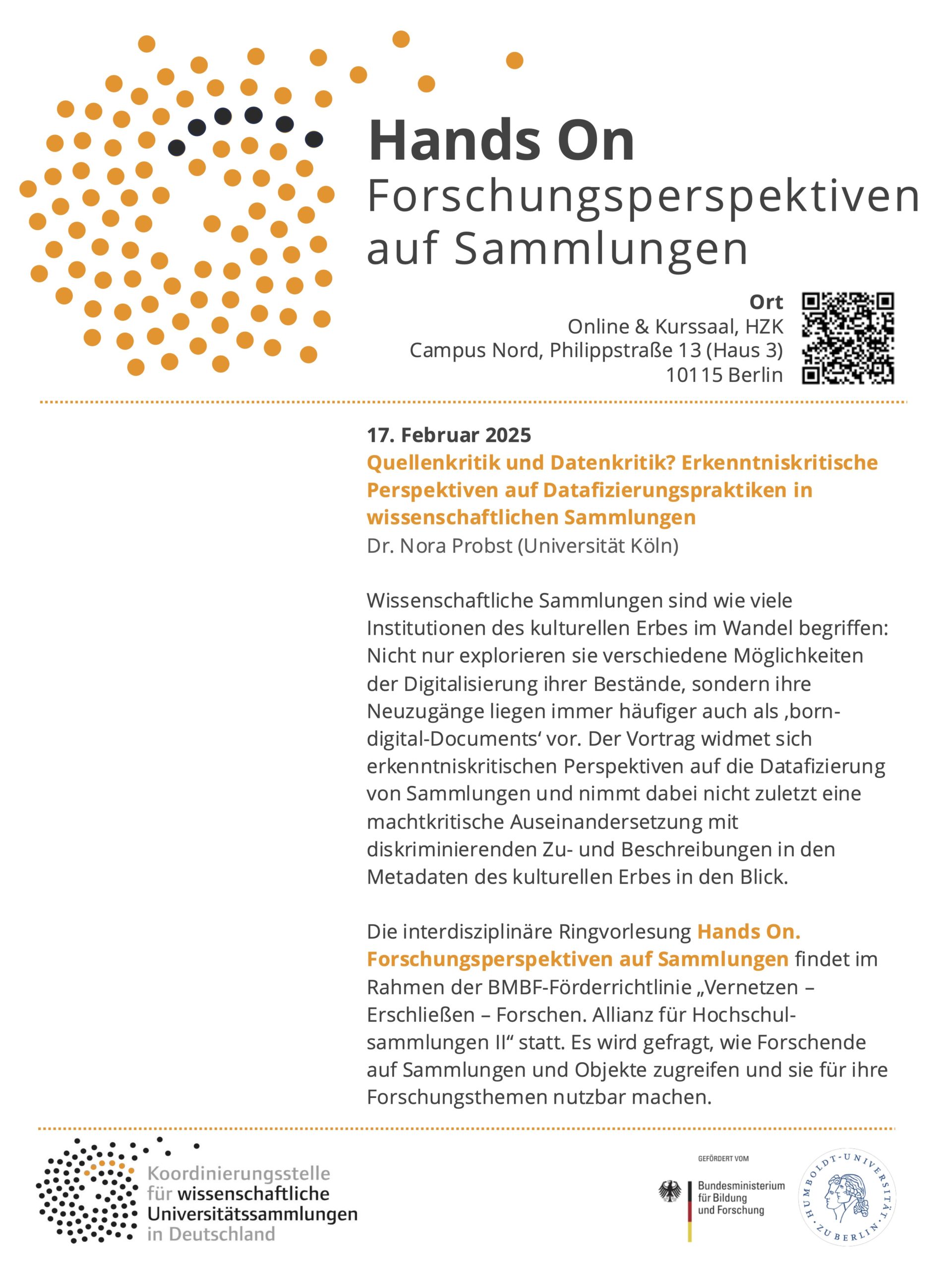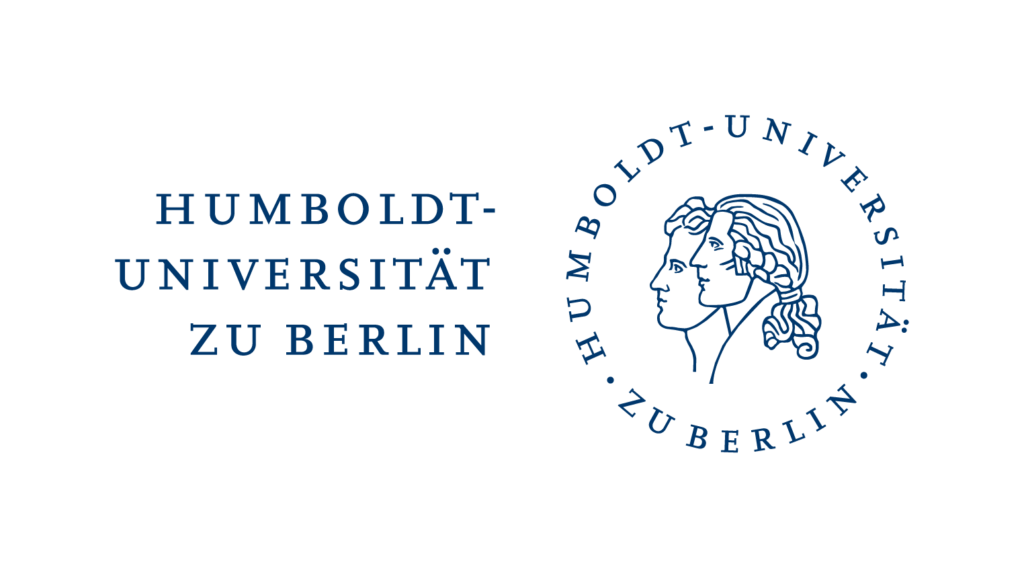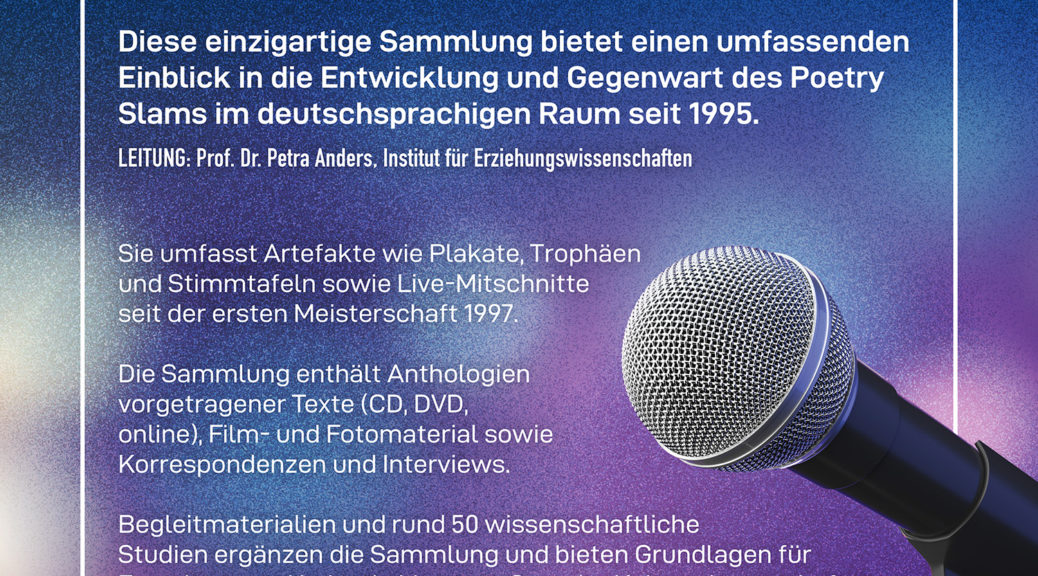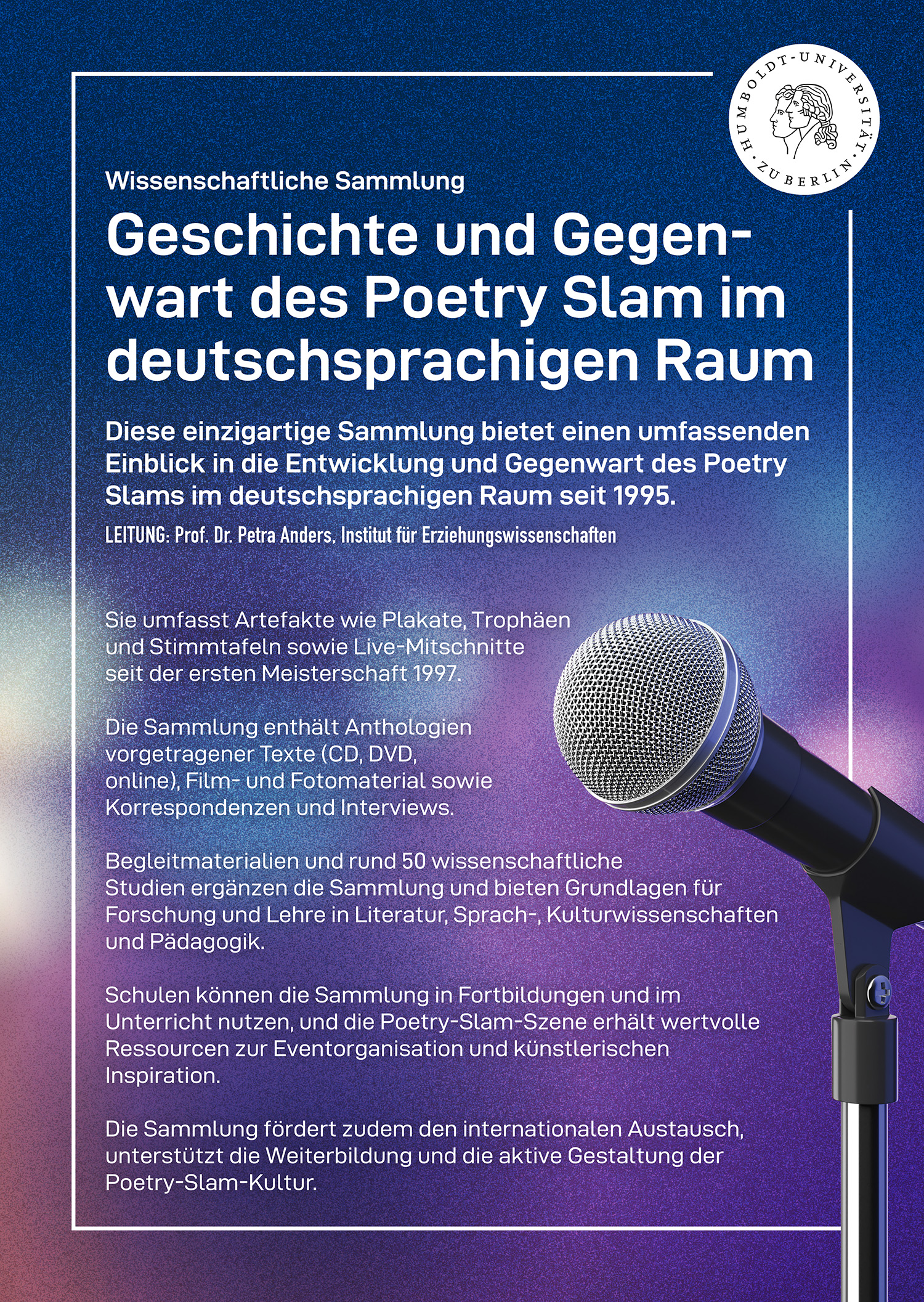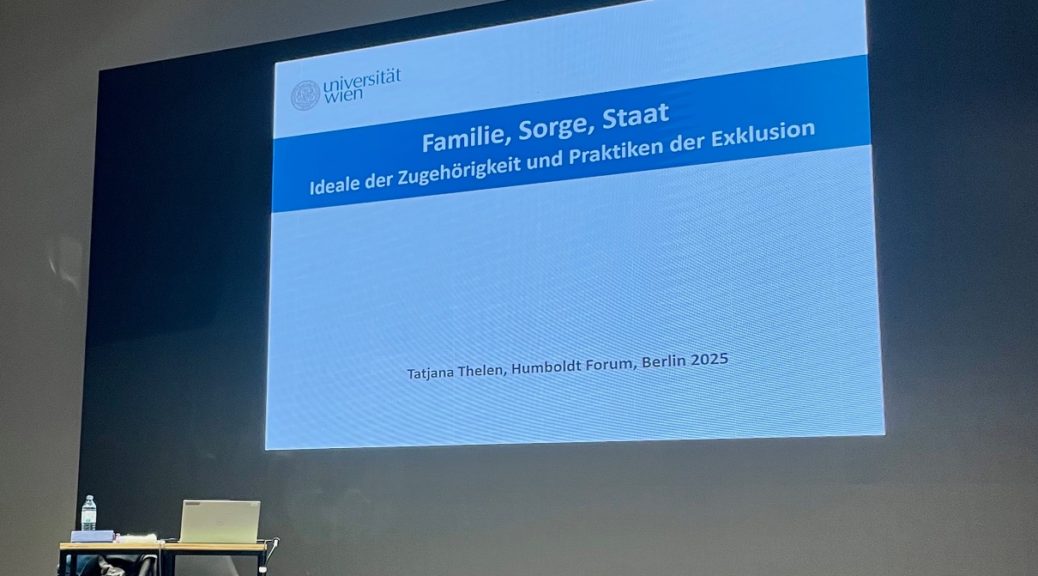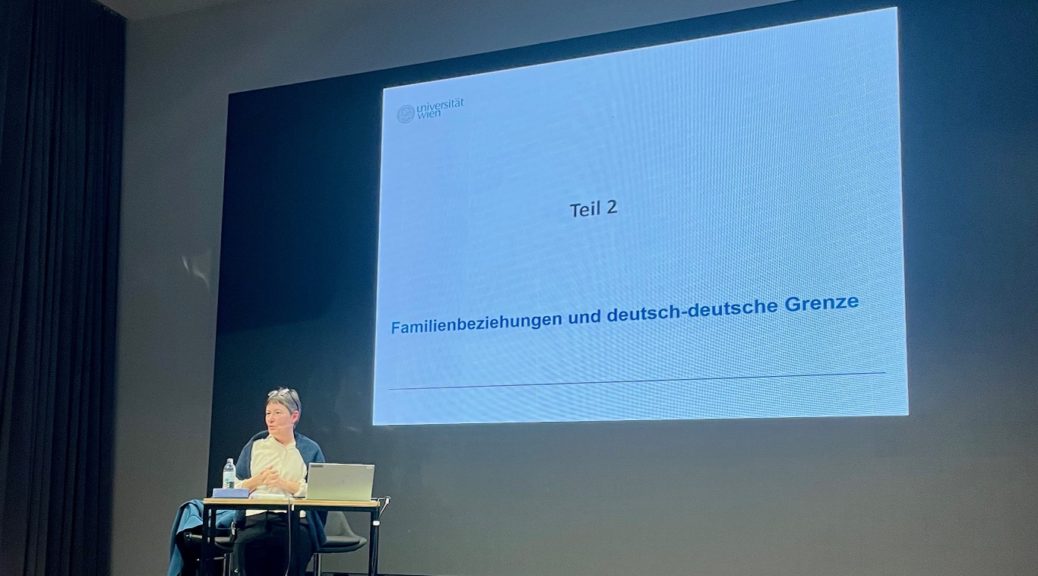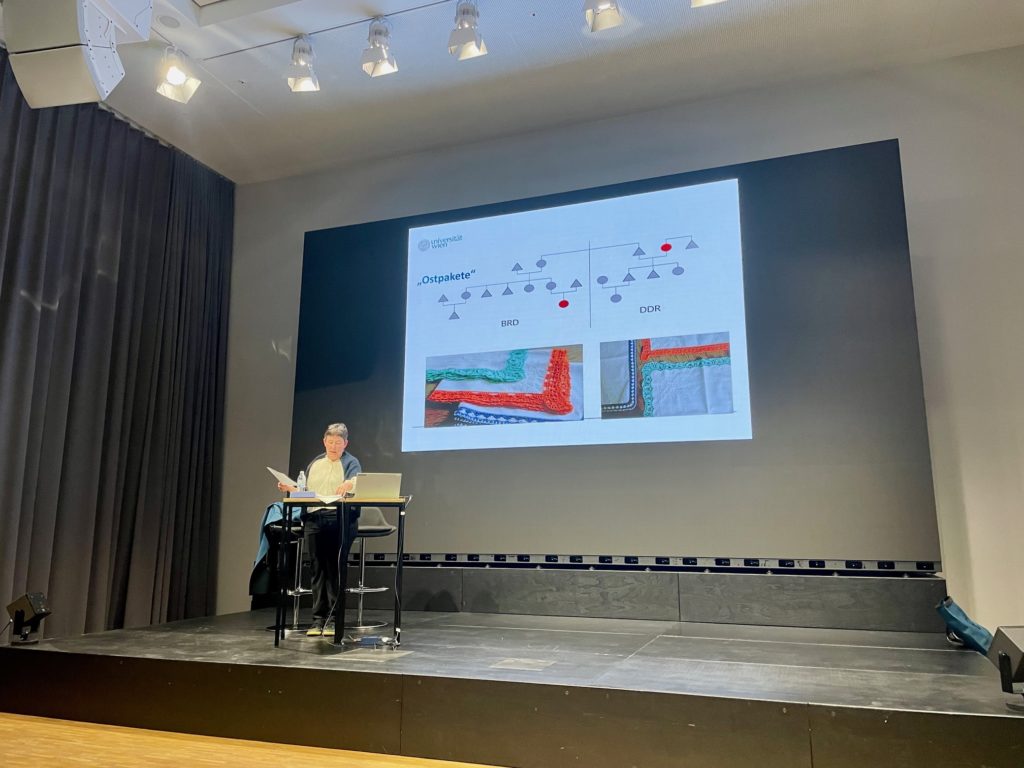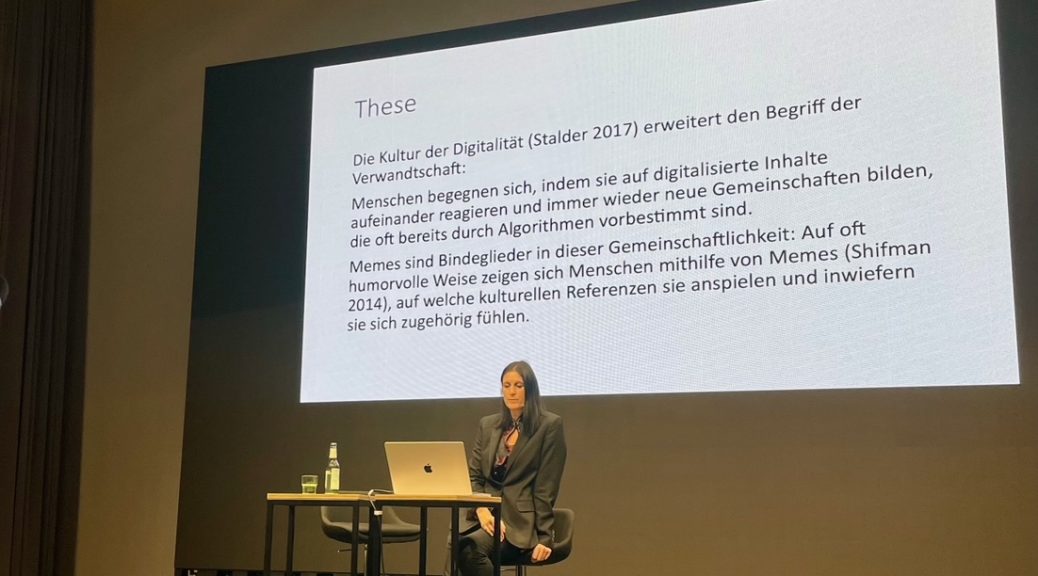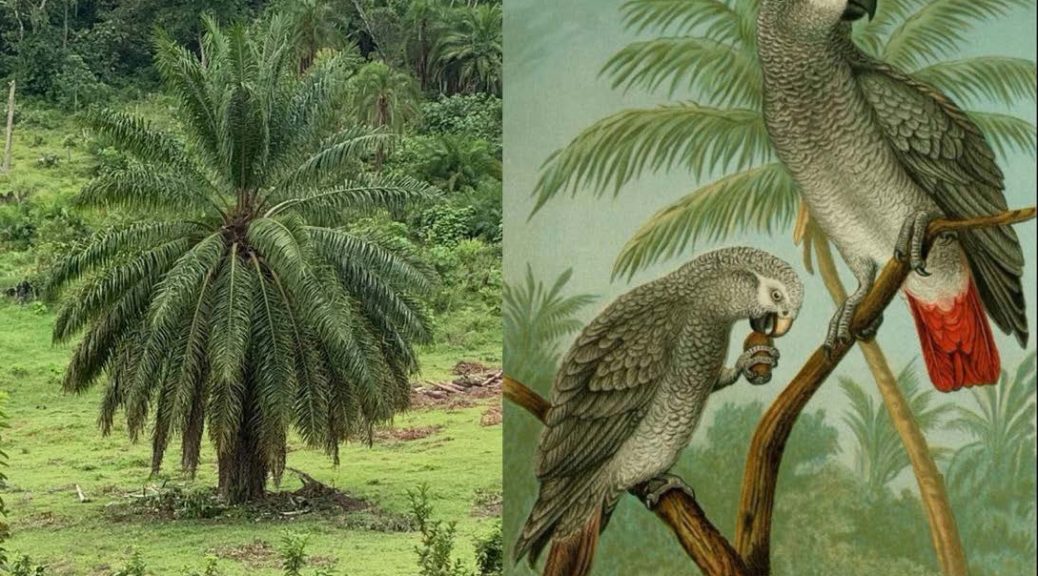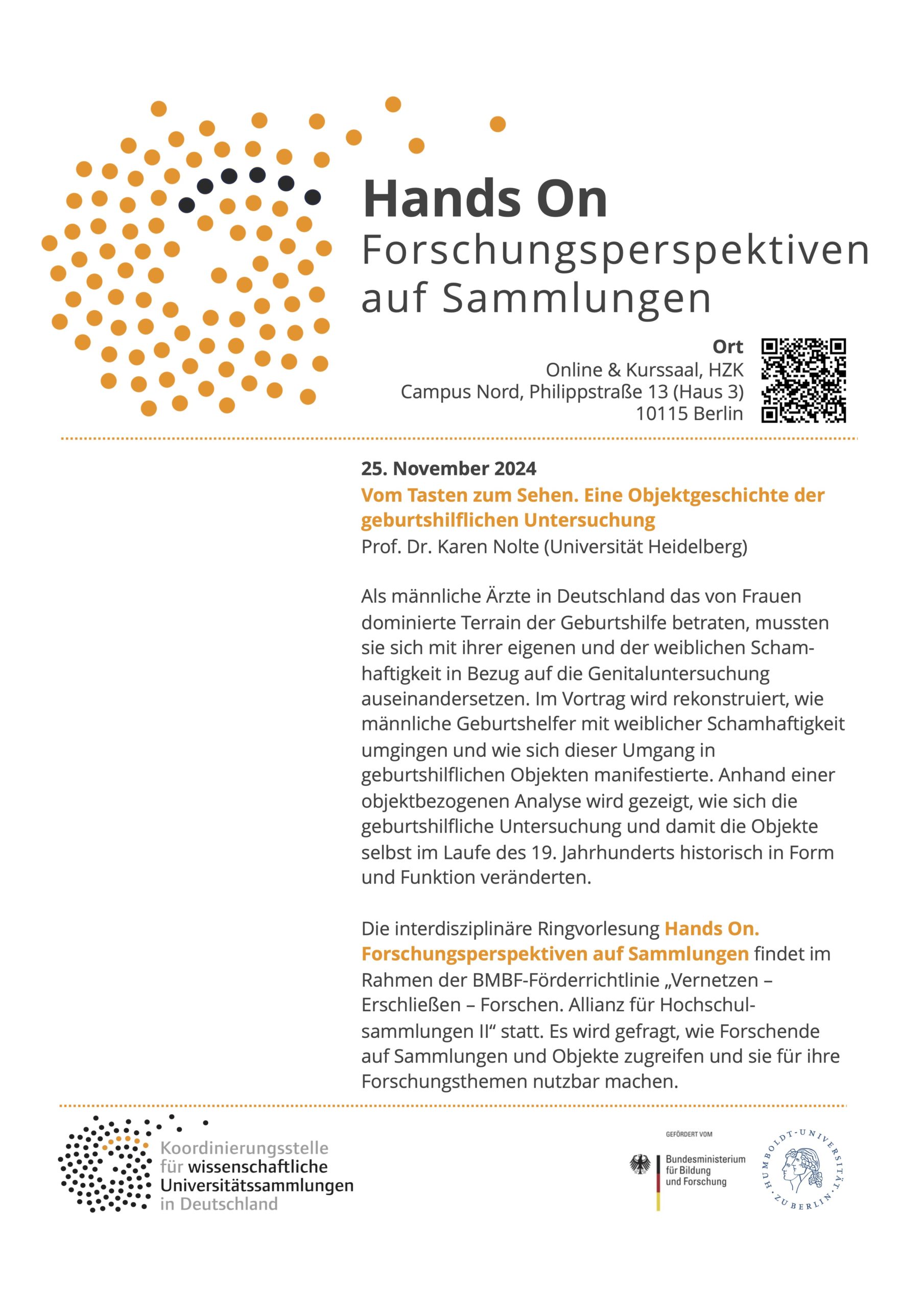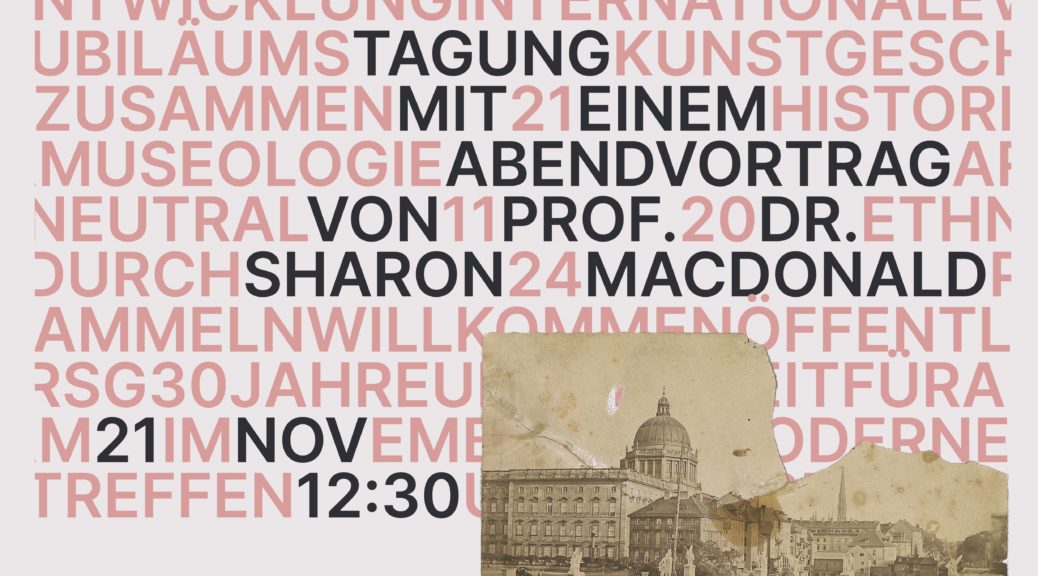Keynotes organisiert von Roxana Coman, Gizem Zencirci, Dr. Belgin Turan-Ozkaya, Dr. Malte Fuhrmann, Habiba Insaf, Emma Jelinski.
Da Erbe eine komplexe Beziehung zum Konzept der Vererbung hat und somit den Begriff des Besitzes voraussetzt, stand es im Zentrum verschiedener politischer Projekte: imperial, lokal, national und zivilisatorisch. Durch die Fokussierung auf (post)osmanische Länder und Vorstellungswelten zielt dieser Workshop darauf ab, Zivilisation, Imperium, Nation und Erbe als Konstrukte im Wandel zu betrachten, die für immer von Individuen, Objekten, Ideen und Orten abhängig sind, die ererbte Bedeutungen tragen und zu Katalysatoren für neue Arten der Bedeutungsgebung werden. Indem wir die Reimagination und Reproduktion des Osmanischen Reiches über Zeit und Ort hinweg untersuchen, untersuchen wir, wie verschiedene politische Projekte in die Praktiken der Erinnerungsbildung und der Schaffung von Erbe eingebunden waren.
Dr. Belgin Turan-Ozkaya und Dr. Malte Fuhrmann werden sich in ihren Vorträgen mit der Vielfalt des Erbes im Osmanischen Reich und seinem ehemaligen kaiserlichen Zentrum, Istanbul, befassen. Dr. Turan-Ozkaya wird sich mit der ethnischen, kulturellen und religiösen Pluralität befassen und damit, wie der post-imperiale Rahmen die Konversation zu einer zunehmenden Türkisierung geführt hat. Dr. Fuhrmann wird die Kommerzialisierung des Kulturerbes in Istanbul durch die aktuellen audiovisuellen digitalen Trends beleuchten und aufzeigen, wie dies die Diskussion über und um das archäologische und historische Erbe weiter erschwert.
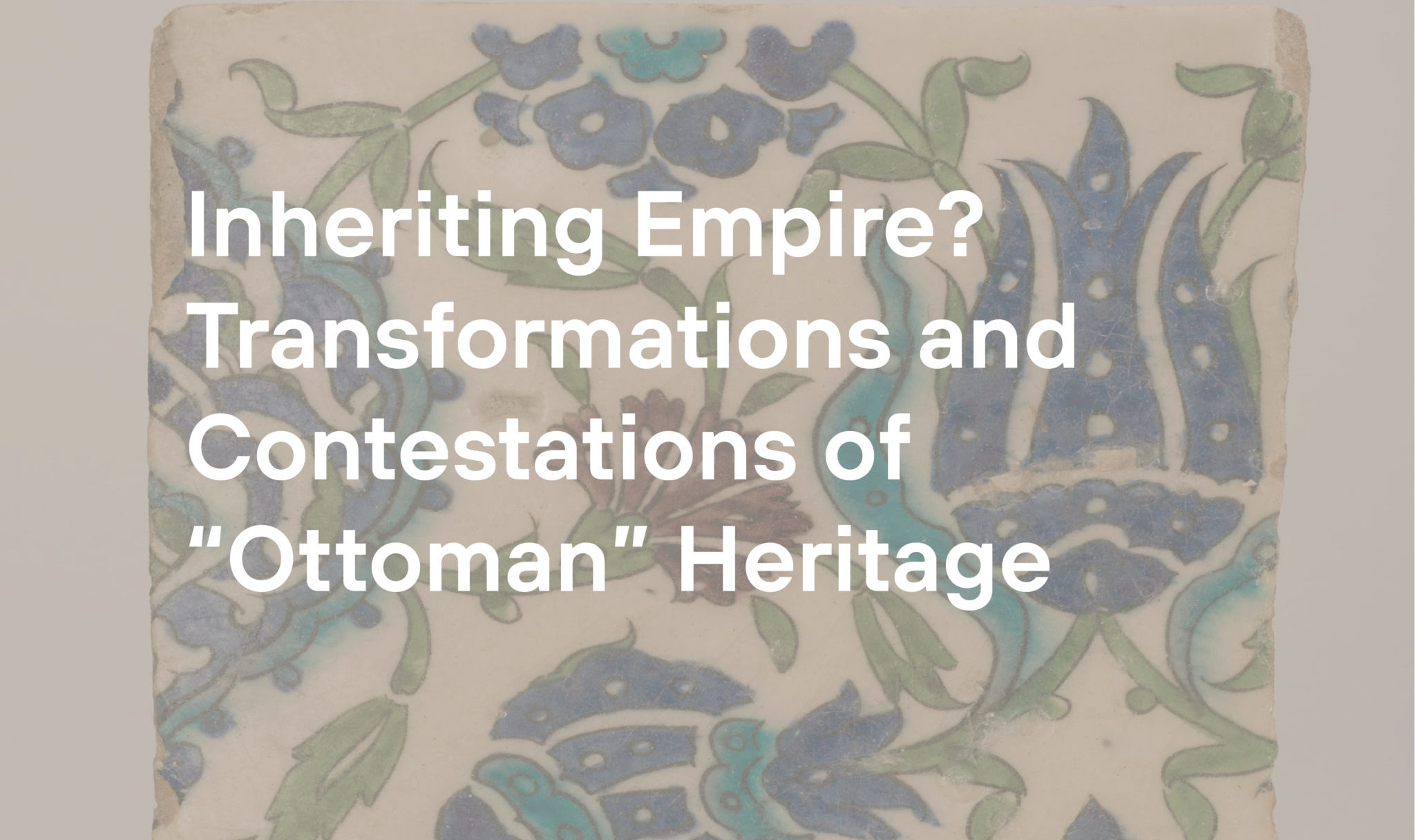
13.01.2025, 17.00 -19.00
HZK Kurssaal
Campus Nord, Philippstr. 13, Haus 3
Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Die Keynotes sind kostenlos und stehen allen offen. Bitte melden Sie sich bis zum 7. März unter der folgenden E-Mail-Adresse an: info-inherit@hu-berlin.de
Weitere Informationen finden Sie hier: https://inherit.hu-berlin.de/events/inheriting-empire-transformations-and-contestations-of-ottoman-heritage