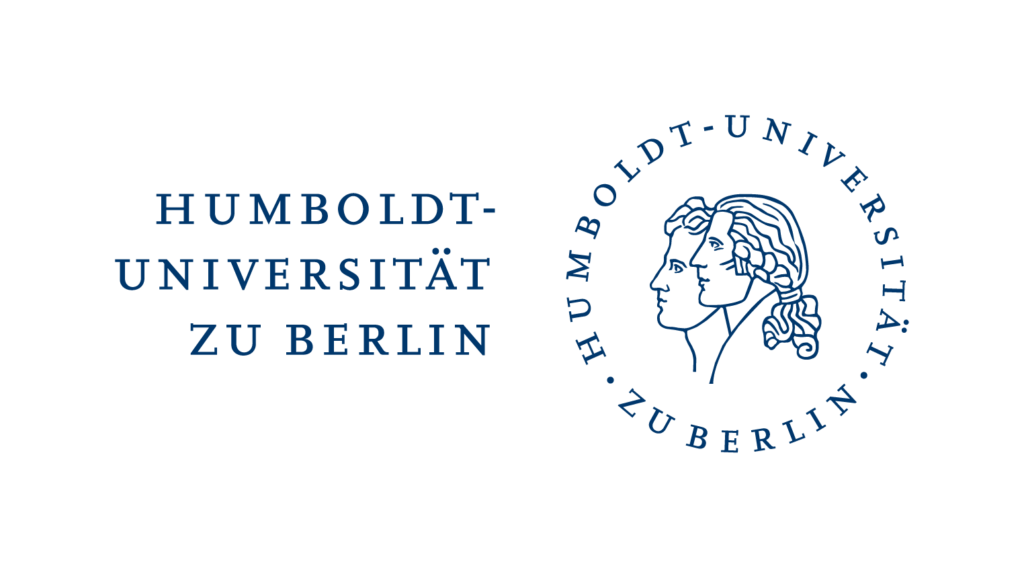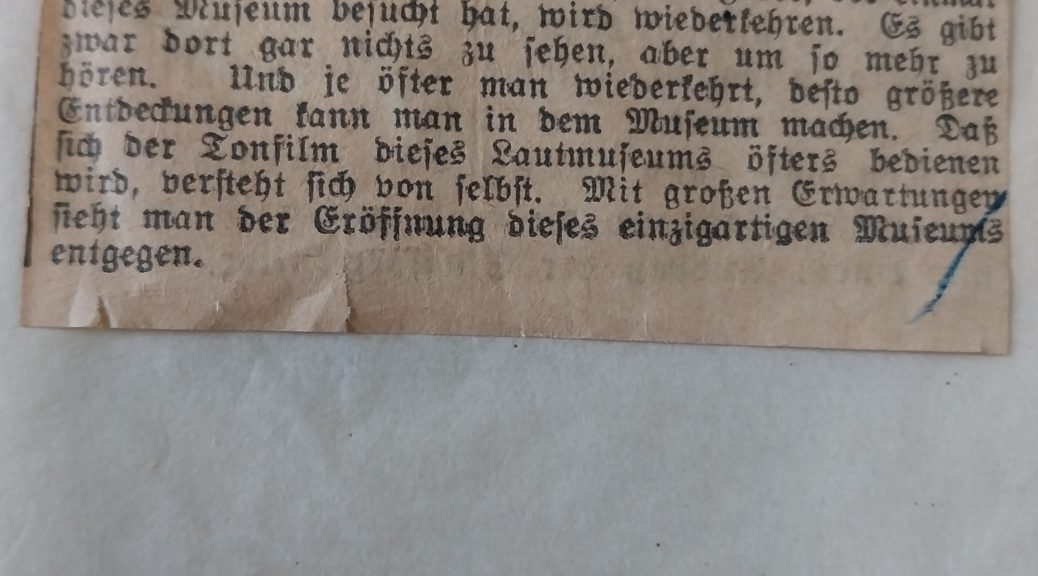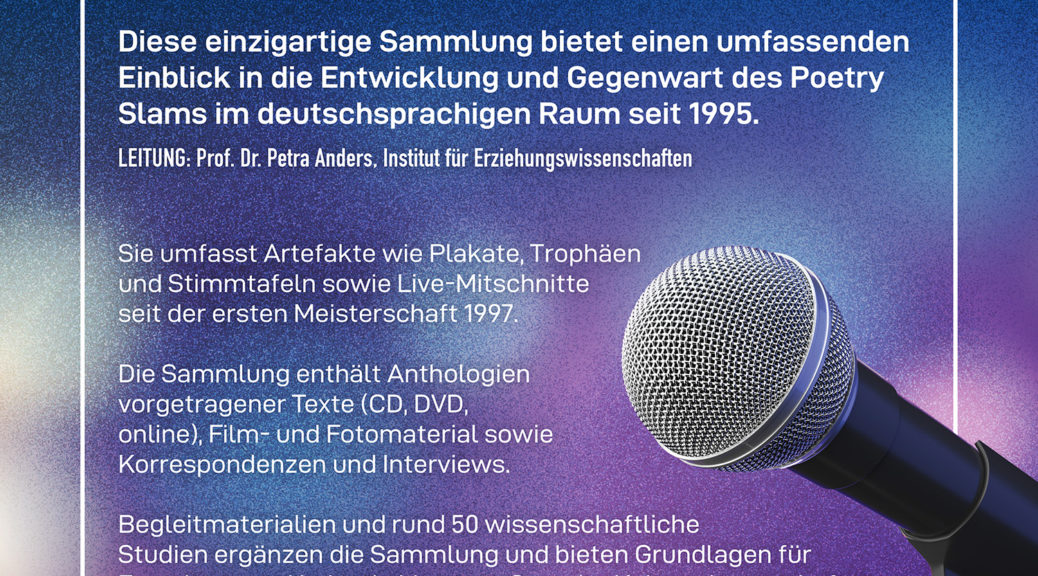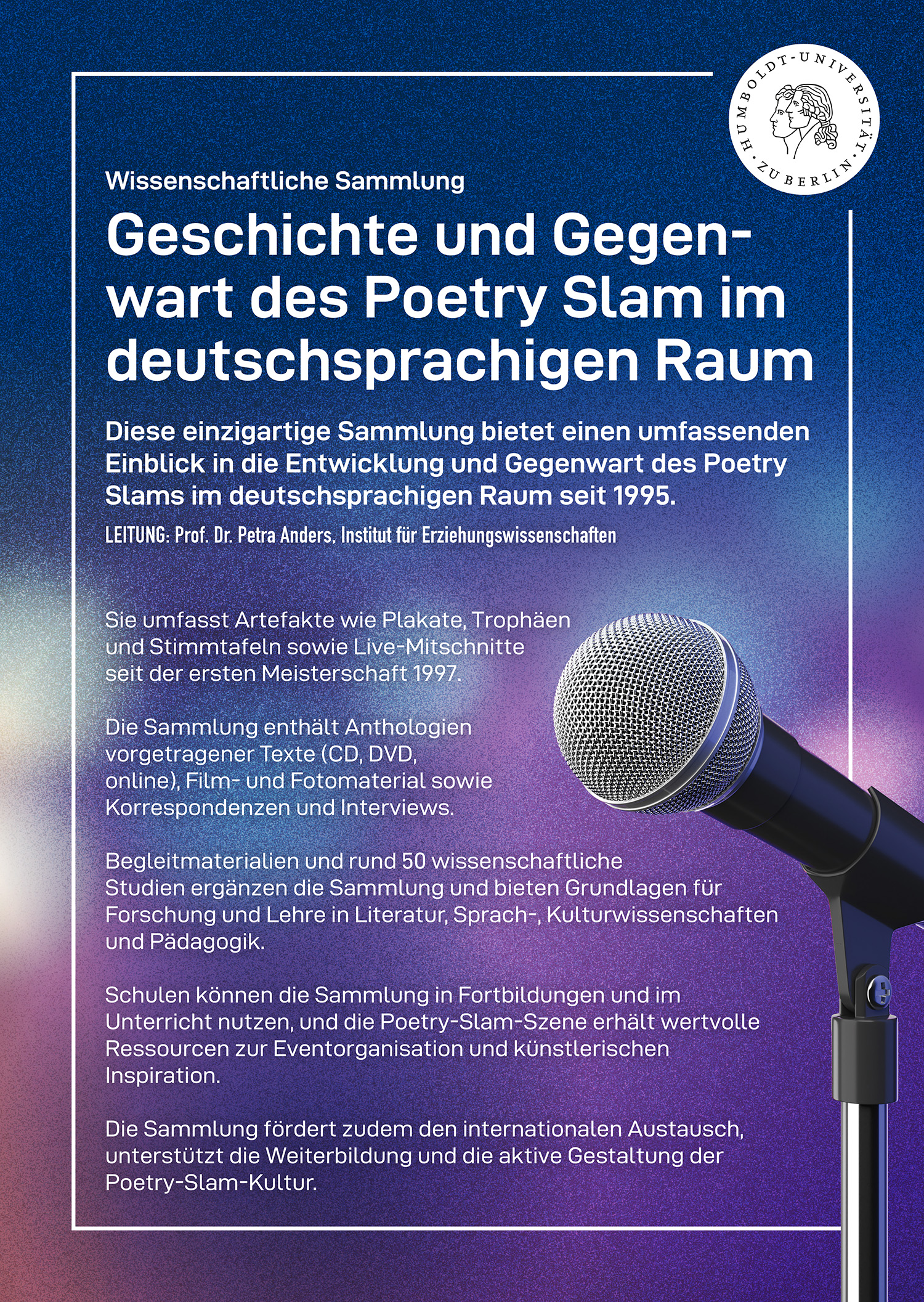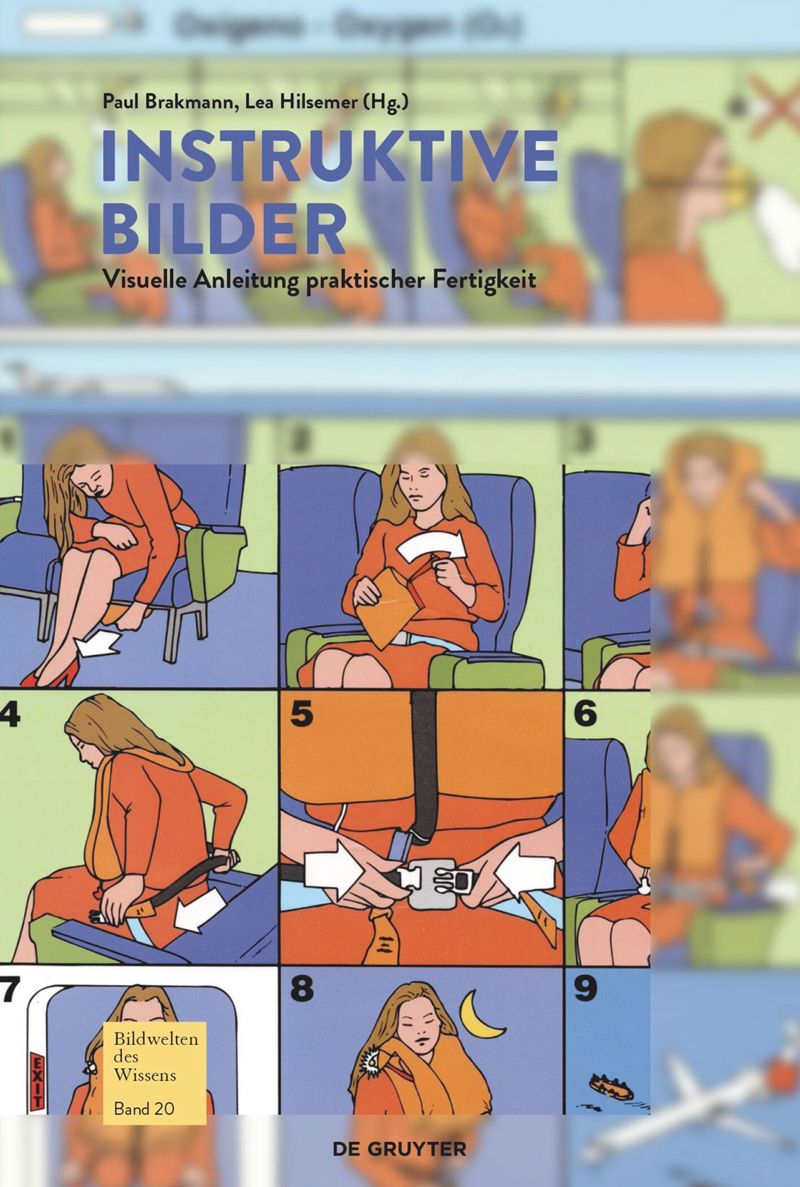Am 05. Februar 2025 um 18:00 findet der nächste Termin der Ringvorlesung „Beziehungsweise Familie“ statt:
(Missing) Intersections of Social Inequality and Population Research – A Call for Further Study
Dr. Andrés F. Castro
Soziale Ungleichheit und Bevölkerungsforschung haben sich als parallele Themen mit wenig Überschneidungen entwickelt. In diesem Vortrag werde ich deskriptive Ergebnisse zur parallelen Entwicklung dieser Forschungsbereiche anhand einer grundlegenden Textanalyse veröffentlichter Forschungsarbeiten von 1960 bis heute vorstellen. Ich werde argumentieren, dass die relative Vernachlässigung sozialer Ungleichheiten in der quantitativen Bevölkerungsforschung mit einer eurozentrischen Voreingenommenheit in den Sozialwissenschaften zusammenhängt, und ich werde diese Voreingenommenheit anhand verschiedener Quellen quantifizieren. Darüber hinaus werde ich Beispiele dafür anführen, wie die Bevölkerungsforschung, insbesondere die Familien- und Fertilitätsforschung, von einem Fokus auf soziale Ungleichheit profitieren könnte. Abschließend werde ich meine Sichtweise darlegen, wie die Erforschung sozialer Ungleichheit über die Bevölkerungsstudien hinaus besser in die Sozialwissenschaften integriert werden könnte.
Der Vortrag findet in englischer Sprache statt.
Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich und steht allen Interessierten frei.
Veranstalterinnen:
Prof. Dr. Daniel Tyradellis (Humboldt-Universität zu Berlin)
Dr. Alia Rayyan (Humboldt-Universität zu Berlin)
Dr. Laura Goldenbaum (Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss)
Ort und Zeit:
05. Februar 2025,
18 bis 20 Uhr
im Saal 3, EG, Humboldt Forum, Schlossplatz.


Dr. Andrés F. Castro ist Computer-Sozialwissenschaftler, Soziologe und Demograf am Computational Social Science and Humanities Program des Barcelona Supercomputing Center (CSSH-BSC). 2019 schloss ich mein Studium an der UN University of Pennsylvania ab und habe seitdem in verschiedenen Forschungszentren in Europa gearbeitet, darunter das Französische Nationale Institut für Demografische Forschung (Ined), das Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock und das Zentrum für Demografische Studien in Barcelona. Zu meinen Forschungsgebieten gehören globale Ungleichheiten in der Wissensproduktion, bibliometrische Analysen und Forschungsbewertung sowie Bevölkerungsstudien mit Schwerpunkt auf Fertilität und Familiendynamik im globalen Süden und bei Einwanderern.