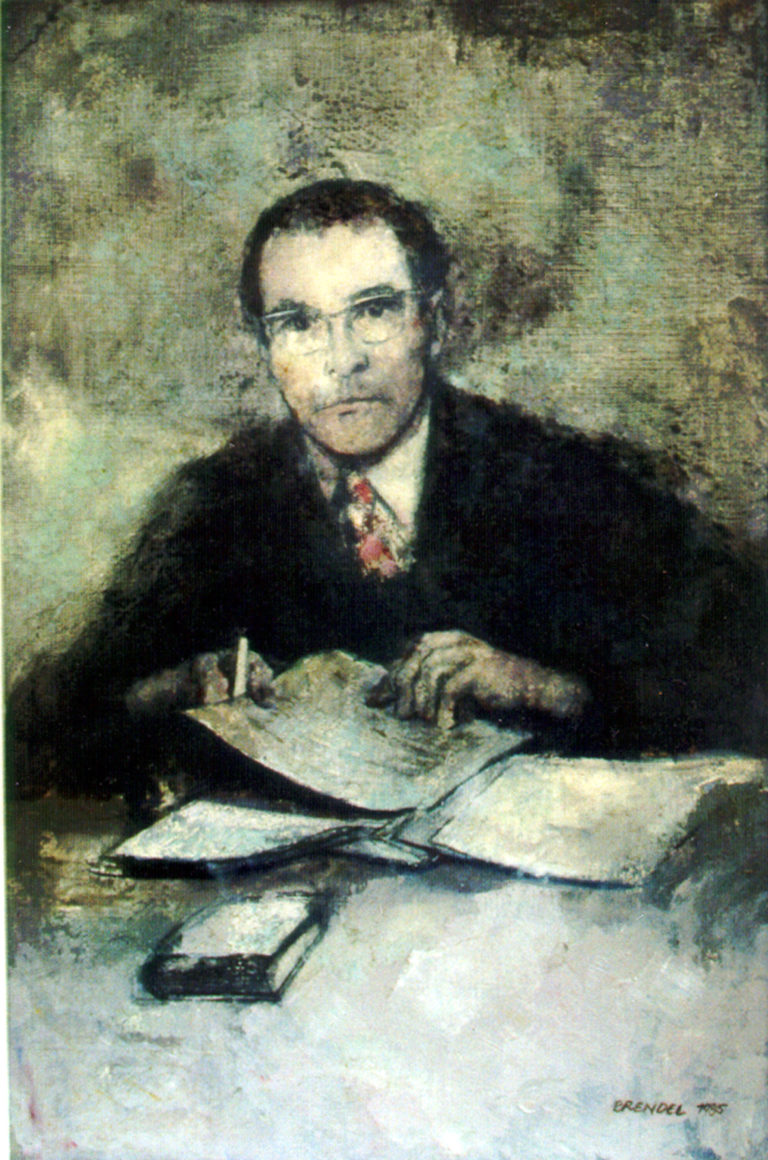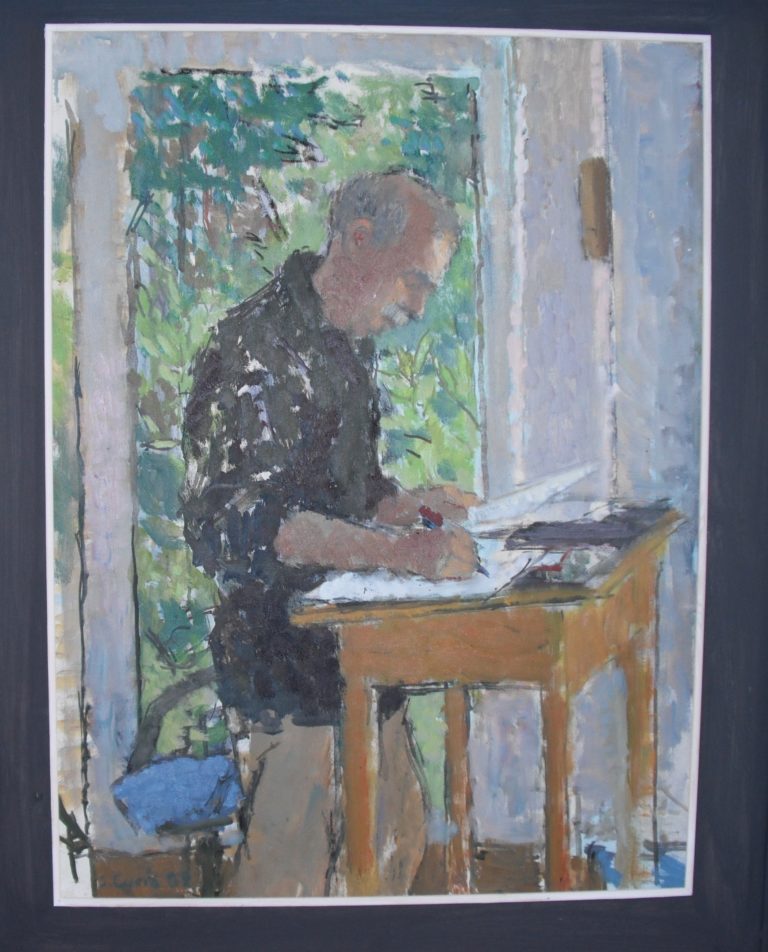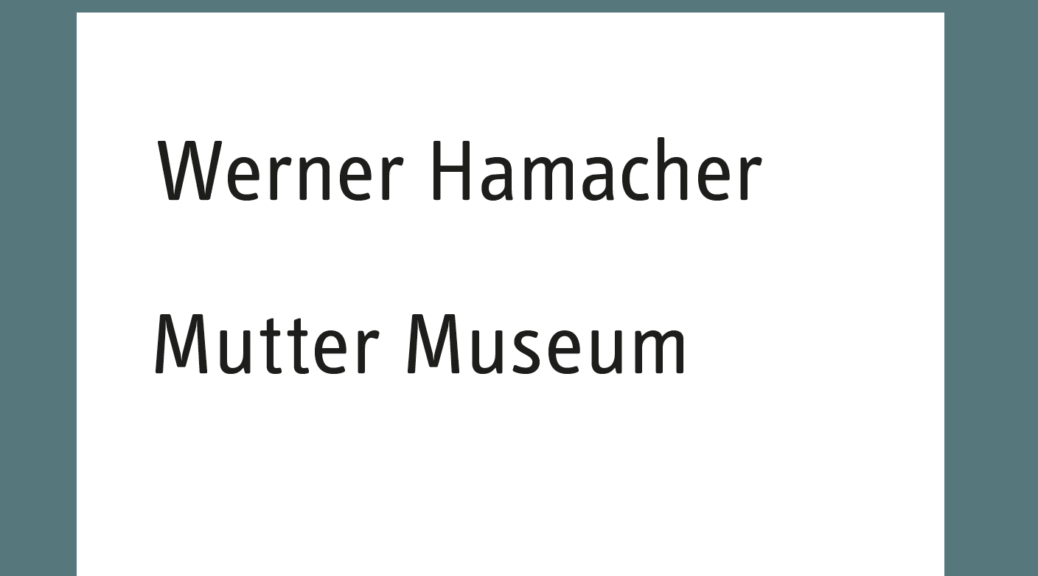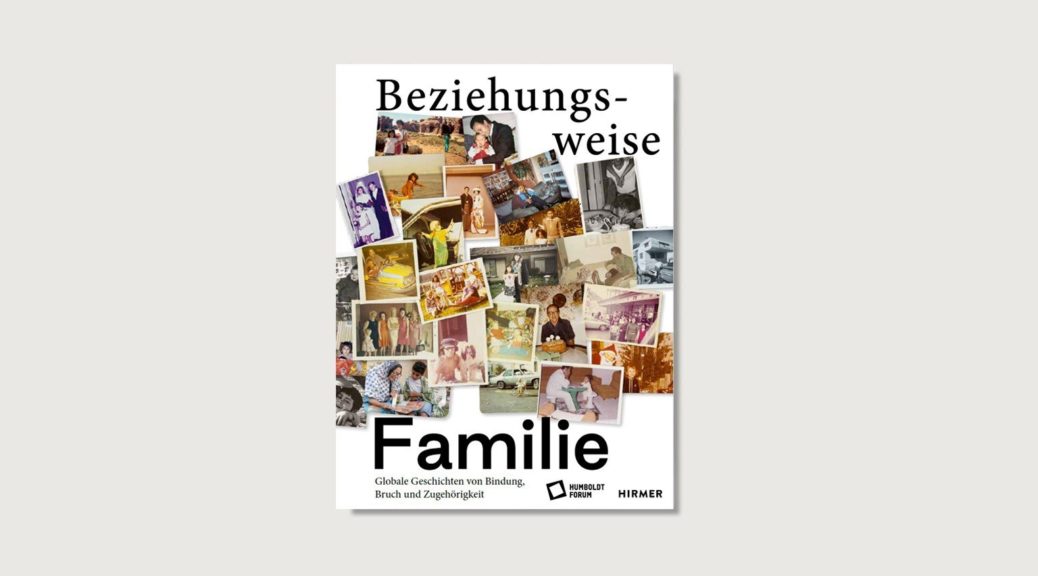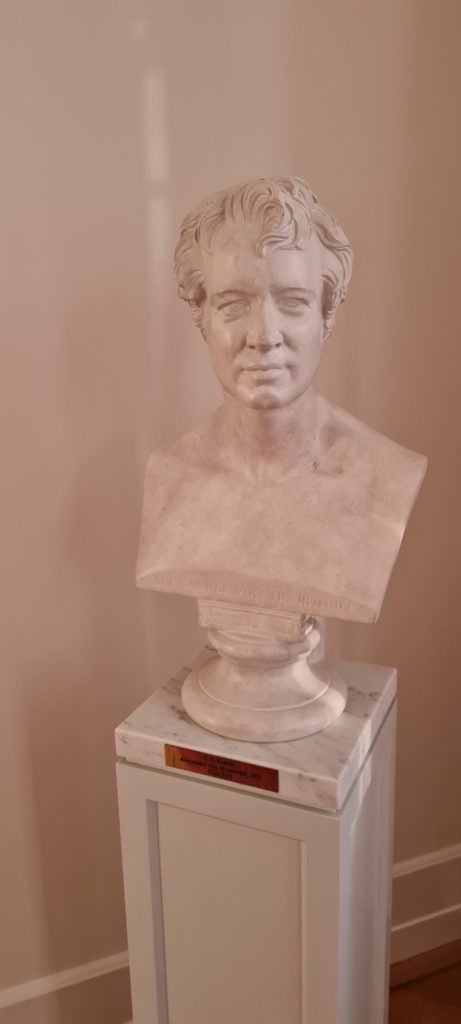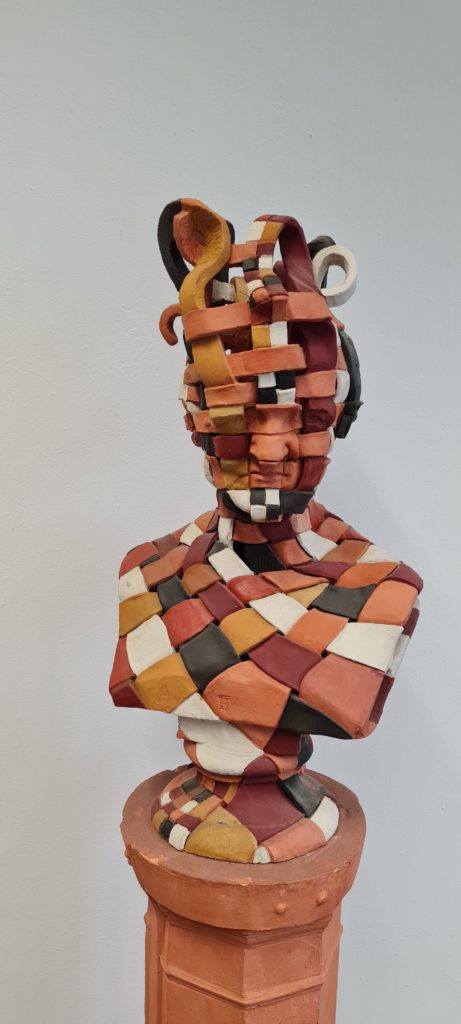Interview mit Jayun Choi, Brown University
Jayun Choi verbrachte den Herbst 2025 an der Humboldt-Universität und absolvierte ein Praktikum beim Kompetenzfeld Wissensaustausch mit der Gesellschaft am Zentrum für Kulturtechnik. Sie unterstützte vor allem universitätsweite Programme im Bereich Wissensaustausch mit der Gesellschaft und organisierte das Fluid Interdisciplinarities Festival mit. Im Interview teilt sie ihre Eindrücke über die Mitarbeit beim Austausch zwischen Universität und Gesellschaft.
Welche Erkenntnis hast du zum Thema Public Engagement gewonnen, insbesondere dazu, wie ein Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft funktionieren kann?
Für mich ist eine wichtige Erkenntnis, dass es beim Public Engagement nicht in erster Linie darum geht, Wissenschaft zu vermitteln oder akademisches Wissen für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Vielmehr geht es darum, Räume für den gegenseitigen Austausch zu schaffen, in denen Menschen teilnehmen, Fragen stellen und eigene Beiträge leisten können. Dies wurde für mich zum Beispiel während der Berlin Science Week deutlich, als Irina Demina, die Choreographin-in-Residenz am ZfK, ihre Forschungsarbeit an der Schnittstelle zwischen Volkstanz und künstlicher Intelligenz vorstellte. Anstatt ihre Arbeit abstrakt zu erklären, lud sie das Publikum ein, ihre Forschung durch Bewegung zu erleben. Sie ermutigte die Menschen, Fragen zu stellen und darüber nachzudenken, wie bewegungsbasierte Praxis als eine Form der Forschung funktionieren kann. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie effektiv Public Engagement als Prozess gemeinsamer Forschung funktionieren kann, bei dem Wissenschaft und Gesellschaft durch gelebte Erfahrung, Neugier und Austausch zusammenkommen.
Welches Projekt während deines Praktikums war für dich am bedeutungsvollsten? Und warum?
Während meines Praktikums war die Arbeit an der Kommunikation von Forschungs- und Kunstprojekten mithilfe sozialer Medien und Festivalmaterialien eines der bedeutungsvollsten Projekte für mich. Bei der Erstellung von Inhalten für Projekte wie die Berlin Science Week, das Förderprogramm „Open Humboldt Freiräume” oder das „Dance Artist in Residence“ Programm habe ich mich darauf konzentriert, komplexe Forschungs- und Kunstpraktiken einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dieser Prozess hat mein Verständnis von Forschungs- und Wissenschaftskommunikation als einen Akt der Gestaltung geschärft, bei dem redaktionelle Entscheidungen darüber bestimmen, wie institutionelles Wissen in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich habe auch gelernt, wie Universitäten durch bewusste Kommunikationsentscheidungen, die Wissenschaft und Öffentlichkeit miteinander verbinden, Vertrauen, Sichtbarkeit und Engagement aufbauen können.
Welcher Teil des Fluid Interdisciplinarities Festivals hat Forschung, Kunst und Gesellschaft deiner Meinung nach am besten zusammengebracht?
Bei dem Fluid Interdisciplinarities Festival sind für mich bei der „Party of the Panke” Forschung, Kunst und Gesellschaft am deutlichsten zusammengekommen. Als offene Veranstaltung mit mehreren Mitmachstationen bot „Party of the Panke“ verschiedene Möglichkeiten, sich mit Flüssen auseinanderzusetzen – wie zum Beispiel in Form von Archivkartierung, geführten partizipativen Touren oder einem bewegungsbasierten Workshop. Anstatt Forschung als etwas zu präsentieren, das beobachtet oder erklärt werden muss, lud jede Station die Teilnehmenden dazu ein, sich durch künstlerische und bewegungsbasierte Methoden direkt mit dem Fluss auseinanderzusetzen. So fühlte sich die Teilnahme wie eine Form der Wissensgenerierung an, statt wie eine reine Rezeption von Wissen durch das Publikum. Das hat mir gezeigt, dass Forschung durch diversere Formen der Begegnung einen Weg in den öffentlichen Raum finden kann, was Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft durch gemeinsame Erfahrungen statt durch einseitige Präsentationen zusammenbringt.
Bist du während deines Praktikums einem Thema, einer Idee oder einem Impuls begegnet, was dich besonders beeindruckt hat und was du für deine zukünftige Forschung oder Arbeit mitnehmen wirst?
Während meines Praktikums war das Kennenlernen der verschiedenen Forschungsansätze von Berliner Wissenschaftler:innen zum Thema Wasser ein bleibender Impuls, der mein Verständnis von Umweltpolitik und -management nachhaltig verändert hat. Die Teilnahme am Fluid Interdisciplinarities Festival war dabei von entscheidender Bedeutung und hat mich dazu veranlasst, mir weitere Initiativen zum Thema Wasser an der Humboldt-Universität und der Berlin University Alliance anzuschauen. Dieses Interesse wurde durch die wasserbezogene Forschung in der Ausstellung „On Water.WasserWissen in Berlin” im Humboldt Labor verstärkt. Die Begegnung mit Projekten zu Flüssen im urbanen Raum, Wasserinfrastruktur oder Klimaanpassung veranlassten mich dazu, genauer darauf zu achten, wie Wassermanagement für die Öffentlichkeit sichtbar wird. Als Studentin mit den Schwerpunkten „International and Public Affairs“ und „East Asian Studies“ habe ich ein gezieltes Interesse für Fragestellungen entwickelt, wie städtische Wasserpolitik gestaltet und durch öffentlichkeitswirksame Projekte in verschiedenen historischen und institutionellen Kontexten vermittelt wird. Das ist etwas, das ich in meiner zukünftigen Arbeit durch vergleichende Forschungsansätze weiterverfolgen möchte.
Das Interview und die Praktikumsbetreuung führte Xenia Muth, Kompetenzfeld Wissensaustausch mit der Gesellschaft. Ein aktuelles Praktikumsangebot im Bereich Public Engagement und Wissensaustausch mit der Gesellschaft finden Sie im Humboldt Internship Program.