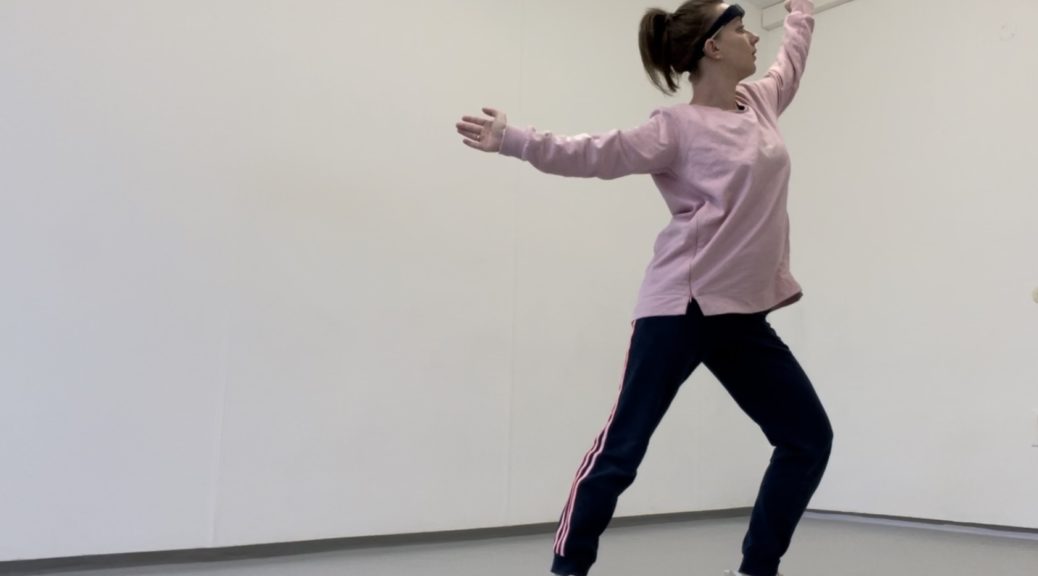Ein neues Seed Funding Programm des Kompetenzfelds Wissensaustausch mit der Gesellschaft unterstützt transdisziplinär durchgeführte Seminare im Objektlabor finanziell und inhaltlich dabei, wissenschaftliche Fragen und Seminararbeit in Kooperation mit der Gesellschaft zu gestalten.
Im Zentrum der Seminare im Sommersemester 2025 steht die Auseinandersetzung mit Archiven, Sammlungen, Medien- oder Kunstobjekten als Träger historischer, politischer und ästhetischer Bedeutungen und Fragen der Darstellung oder auch des Verbergens. Durch forschungsorientierte, kuratorische und künstlerisch-praktische Zugänge experimentieren fünf Seminare mit Praktiken des Sichtbarmachens, Löschens, Transformierens und Neudenkens.
„Overloaded! Inter-Imperiale Verflechtungen von Materiellen und Fotografischen Sammlungen in Berlin und Wien“ (Café Interimperial)
Prof. Dr. Magdalena Buchczyk (Institut für Europäische Ethnologie), Dr. Hanin Hannouch (Weltmuseum Wien) und Anna Szöke (Ethnologisches Museum/Asian Art Museum)
Das Café Interimperial ist eine öffentliche, von Studierenden organisierte Veranstaltung, die im Rahmen des MA-Seminars Overloaded! Inter-imperial Entanglements of Material and Photographic Collections in Berlin and Vienna (Institut für Europäische Ethnologie) stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem Weltmuseum Wien und dem Ethnologischen Museum Berlin beschäftigen sich die Studierenden des Seminars mit den inter-imperialen Beziehungen, die sich in den Sammlungen von Fotografie und der materiellen Kultur in beiden Städten widerspiegeln. Das Café Interimperial verwandelt das Objektlabor für einen Tag in einen Pop-up-Raum für Austausch und Einblicke in die laufenden Forschungsprojekte der Studierenden. Die Veranstaltung lädt Wissenschaftler*innen und die interessierte Öffentlichkeit dazu ein, mit den Arbeiten der Studierenden, die die vielschichtige Geschichte verschiedener Objekte und Bilder Berlins und Wiens beleuchten, in einen Dialog zu treten. (Seminar auf Deutsch und Englisch)
Café Interimperial:
- Wann: Dienstag, 8. Juli, von 14:30 bis 18:00 Uhr
- Wo: Objektlabor, Zentrum für Kulturtechnik,
HU Berlin, Campus Nord, Haus 3,
Phillipstraße 13, 10115 Berlin (Hinweise zur Anfahrt)
- Zur Verpflegung stehen Kaffee und eine Auswahl an tollen Kuchen bereit.
- Bei Interesse bitten wir um eine kurze Voranmeldung an: wissensaustausch.hzk@hu-berlin.de.
„Öffentlichkeit und Zensur. Zur materiellen Kultur von Bild- und Sprechverboten“
Dr. Katja Müller-Helle (Das Technische Bild, Institut für Kunst- und Bildgeschichte) und Dr. Alia Rayyan (Theorie und Praxis des Kuratierens, Zentrum für Kulturtechnik)
Die praxisorientierte Übung wirft einen historisch-systematischen Blick auf die Begriffe von Öffentlichkeit und Zensur und auf die spezifisch materiellen Praktiken ihrer kontextabhängigen Umsetzung: Blurring-Effekte, schwarze Balken, Überblendungen und Übermalungen reichen tief in die Debattengeschichte von Inhaltsregulierung hinein und sind gleichzeitig hoch aktuell und in ständiger Transformation. Der Kunstraum nimmt hinsichtlich des Umgangs, der Rahmensetzung oder Ausweitung des Sag- und Zeigbaren eine Sonderstellung ein: Er kann als Experimentierfeld verstanden werden, durch das Praktiken der Zensur umgangen, erweitert, überschrieben oder auch eingefordert werden. Hengame Hosseini, eine Künstlerin aus Teheran, deren Arbeit aus der gelebten Erfahrung innerhalb des soziopolitischen Kontexts im Iran heraus entsteht, wird das Seminar mitgestalten. Aus ihrer Perspektive als beobachtende Zeitzeugin spricht sie über öffentliche Räume, Sichtbarkeit und die visuelle Sprache des Widerstands – etwa im Rahmen der Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘, in der sich die Straße als Ort eines fortlaufenden Dialogs zwischen Repression und Ausdruck manifestierte. (Seminar auf Deutsch)
„Die Werkstatt der Kulturen archivieren: (post)migrantische Geschichten in den Künsten Berlins“
Dr. Habiba Hakimuddin Insaf (Institut für Kunst und Bildgeschichte) und Juana Awad (inherit.heritage in transformation)
Die Werkstatt der Kulturen (WdK) in Berlin war von 1993 bis 2019 die einzige staatlich geförderte Einrichtung der Stadt, die sich der Präsentation von Kunst und Kultur migrantischer Akteur*innen und Schwarzen und POC (People of Colour) Communities widmete. Mit Formaten wie Festivals, Konzerten, Filmvorführungen, Workshops und transnationalen Kooperationen bot sie eine Plattform für künstlerische Experimente für Einzelpersonen und Gruppen, die von anderen staatlich geförderten Kulturräumen in der Stadt weitgehend ausgeschlossen waren. Nach der Schließung durch den Berliner Senat hinterließ die WdK umfassendes Archivmaterial, das heute 205 Kisten mit offizieller Korrespondenz, Fotos, Videos, Flyern usw. umfasst und die Arbeit von dreißig Jahren (post)migrantischer Kunst- und Kulturpräsentation in der Stadt dokumentiert. Das Seminar untersucht die Materialien in Zusammenarbeit mit dem treuhänderischen Verwalter der Archivsammlung, dem Migrationsrat Berlin e.V. als lokalem gesellschaftlichen Akteur. Anhand von Schlüsselfragen zu den Begriffen Archivierung und Präsentation erstellen die Teilnehmer*innen ein Grobverzeichnis der Archivsammlung und recherchieren und kuratieren Beispiele für die öffentliche Präsentation in Form einer virtuellen Ausstellung. (Seminar auf Deutsch und Englisch)
„Meet the Sponges: Curating Dark Ecology, Deep Immersion, Shifting Senses and Other Relationality“
Felix Sattler (Kurator des Tieranatomischen Theaters, Zentrum für Kulturtechnik)
MEET THE SPONGES erprobt kuratorische Strategien für eine neue Zugänglichkeit von Universitätssammlungen. Es integriert dabei u.a. Methoden aus der multimodalen Anthropologie und der künstlerischen, praxisbasierten Forschung. Das Seminar arbeitet mit dem sogenannten Tiefseekabinett, das mikroskopische historische Präparate von Glasschwämmen aus der Zoologischen Lehrsammlung der HU enthält. Die Teilnehmer*innen des Projekts experimentieren mit der Etablierung einer neuen Beziehungsästhetik und -ethik zwischen Lebensformen der Tiefsee und Menschen. Das Seminar wird gerahmt durch die Diskussion von naturkundlichen Berichten und theoretischen Positionen aus den Curatorial Studies, Material Culture Studies, Science and Technology Studies (STS), Öko- und Hydrofeminismus. Als Ergebnisse des Seminars werden Prototypen für eine Ausstellung von Studierenden im Austausch mit akademischen und gesellschaftlichen Akteuren vorbereitet. (Seminar auf Englisch)
“Lehrveranstaltung des Menzel-Dachs mit Matt Saunders: Remediations“
Dr. Jakob Schillinger (Menzel-Dach, Institut für Kunst- und Bildgeschichte) und Matt Saunders (Department of Art, Film and Visual Studies, Harvard University)
Ausgehend von Matt Saunders‘ eigener künstlerischer Praxis untersucht diese praxisorientierte Lehrveranstaltung Prozesse der „Remediation“ und des Transfers zwischen verschiedenen Medien. Ausgehend von der Malerei geht Saunders‘ Werk poröse und provokative Beziehungen zu anderen künstlerischen Formen ein, insbesondere zu Fotografie, Druckgrafik und Installation von Animationsfilmen. Um verschiedene Praktiken miteinander zu verknüpfen, umfasst der Kurs die Zusammenarbeit mit dem Steindrucker Ulrich Kühle. Dieser Ansatz des Maker-zentriertes Lernens und Lehrens wird von Matt Saunders, dem Zentrum für Kulturtechnik und dem Menzel-Dach, das demnächst als Ort für die Erkundung von künstlerischer Praxis in Forschung und Lehre wiedereröffnet wird, geteilt. (Seminar auf Englisch)
Kontakt:
Bei Fragen zum Progamm wenden Sie sich gerne an
Xenia Muth
Leonie Kubigsteltig
Kompetenzfeld Wissensaustausch mit der Gesellschaft
Tel: +49(0)30 2093-12892 | -12881
Email: wissensaustausch.hzk@hu-berlin.de